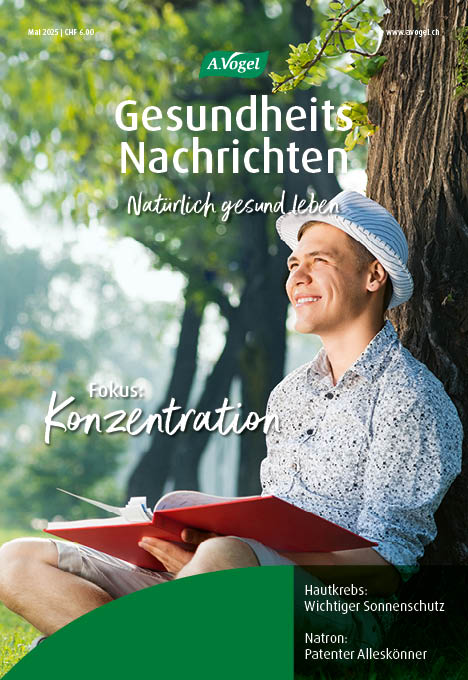A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.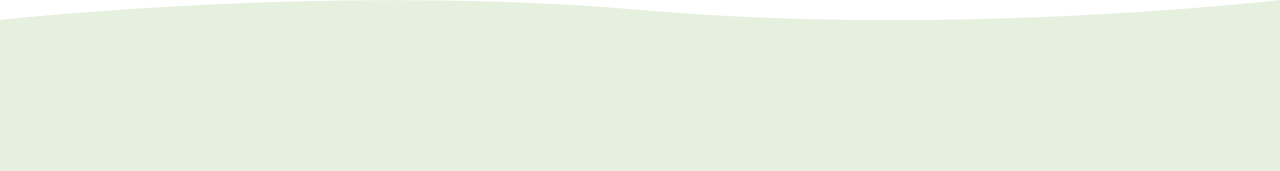
Wenn Chemikalien wie Hormone wirken
Risiko Umwelthormone
Fachleute halten mehr als 1000 hormonwirksame chemische Verbindungen für schädlich und fordern, bekannte Substanzen umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. Über die Frage, welche Mengen zu gesundheitlichen Konsequenzen führen, gehen die Meinungen auseinander.
Autorin: Gisela Dürselen, 10/19
- Das Hormonsystem
- Können hormonaktive Substanzen dem Baby schaden?
- Worin stecken die hormonaktiven Substanzen?
- Lassen sich die krankmachenden Stoffe nachweisen?
- Wie wirken sich die Umwelthormone aufs Ökosystem aus?
- Was kann man selbst gegen Umwelthormone tun?
- Können auch Pflanzenhormone schädlich sein?
Hunderte von Hormonen wirken im menschlichen Körper. Eine genaue Zahl steht nicht fest, denn immer wieder werden neue Hormone identifiziert. Als Botenstoffe steuern sie wichtige Prozesse wie die kindliche Entwicklung, den Wasserhaushalt, Kalziumspiegel und Blutdruck. Sie spielen eine Rolle in der optimalen Funktion des Immunsystems und beeinflussen Emotionen. Kurzum: Das Hormonsystem, das aus den sogenannten endokrinen Drüsen und Zellen sowie ihren Botenstoffen besteht, steuert wesentliche Stoffwechselvorgänge und Organfunktionen.
Die einzelnen Teile dieses Systems agieren dabei als Netzwerk und arbeiten gut aufeinander abgestimmt zusammen. Dockt ein Botenstoff an einer Zelle an, so kann dies, wie zum Beispiel bei Stress, zu einer komplexen Kettenreaktion mit der Bildung weiterer Hormone führen.
Auch körperfremde Substanzen können hormonähnliche Reaktionen auslösen. Sie gelangen über Medikamente oder die Nahrung in den Körper, in anderen Fällen durch Reinigungsmittel, Industrie- oder Körperpflegeprodukte. Schon seit Anfang der 1990er-Jahre steht eine ganze Reihe solcher Chemikalien in Verdacht, die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schädigen. Umwelthormone, Xenohormone oder endokrine Disruptoren (EDs) werden solche Stoffe genannt, die mit einer Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören hormonabhängige Krebsarten wie Prostata- und Brustkrebs, Schilddrüsen- und Stoffwechselerkrankungen, Autismus und Fettleibigkeit und eine verminderte Fortpflanzungsfähigkeit.
Die sogenannten EDs wirken aufgrund ihrer täuschenden Ähnlichkeit zu den körpereigenen Hormonen. An deren Stelle können sie am Rezeptor einer Zelle andocken und die Wirkung von körpereigenen Hormonen verstärken oder blockieren: beispielsweise, indem sie Enzyme angreifen, die für den Abbau eines Hormons zuständig sind. Oder indem sie ein natürliches Hormon vortäuschen, so dass der Körper nur noch wenige davon selbst produziert.
Als besonders bedenklich gelten fettlösliche Stoffe, die sich in Geweben von Organismen und in der Umwelt anreichern können. So wie zwei der ersten Chemikalien, die als hormonaktiv identifiziert wurden: das Pestizid DDT und Dioxine, die in den 1970er-Jahren als «Seveso-Gift» in die Schlagzeilen gerieten.
Mit Nachdruck forschen Wissenschaftler an den Wirkungen solcher fettlöslichen Stoffe während Schwangerschaft und Stillzeit: Mehrere Studien weisen darauf hin, dass hormonaktive Substanzen über das Blut in den Fötus gelangen, sich in fetthaltiger Muttermilch anreichern und an das Neugeborene weitergegeben werden.
Die Schweizer Toxikologin Dr. Margret Schlumpf testete menschliche Muttermilchproben auf ganz verschiedene Chemikalien, darunter hormonaktive UV-Filter, wie sie in Sonnencremes und Kosmetika vorkommen. Bei vielen der stillenden Mütter fanden sich die fraglichen UV-Filter. Wobei die Konzentrationen in der Muttermilch korrelierten mit der Verwendung von Sonnencremes und UV-filterhaltigen Kosmetika durch die Mutter.
Dr. Margret Schlumpf hält diesen Befund für besorgniserregend: «Alle Frühphasen, besonders die vorgeburtlichen, sind sensibel, ja hochsensibel gegenüber hormonaktiven Substanzen. Charakteristisch ist, dass man zwar einiges über Mengen weiss, jedoch noch wenig Genaues über Wirkungen in frühen Entwicklungsperioden. Dort spielen Hormone eine viel wichtigere Rolle als später. Sie sind wegweisend für die weitere Entwicklung des Menschen.»
Bei der Auswahl von Sonnenschutz für Kinder empfehle sich daher eine kritische Beratung, sagt Dr. Schlumpf. Sie rät zu Produkten alternativer Kosmetikfirmen und von diesen speziell zu solchen, die für den Gebrauch für Kinder empfohlen werden. Diese enthielten keine Zutaten wie Benzol, Trisiloxan oder Drometrizol. «Sie entfalten ihren Schutz, indem sie durch kleine Partikel das Sonnenlicht reflektieren und so auf der Haut liegenbleiben, wo sie einen weisslichen Film hinterlassen, jedoch kaum durch die Haut penetrieren.»

Beim Einkauf auf hormonaktive Inhalts-stoffe achten: Da gilt es, die Zutatenliste zu studieren.
Kosmetikprodukte von der Zahnpasta über die Sonnencreme bis hin zum Duschgel sind nicht die einzigen Quellen für einen Kontakt mit hormonaktiven Chemikalien: Sogenannte endokrine Disruptoren wurden in Hausstaub und Pestiziden festgestellt, auch in vielen alltäglichen Kunststoffprodukten, wo sie als Desinfektions- und Konservierungsmittel oder als Weichmacher wirken. So wie die Chemikalie Bisphenol A (BPA), die unter anderem in Verdacht steht, ursächlich beteiligt zu sein an den sogenannten Kreidezähnen bei Kindern, bei denen der Zahnschmelz viel weicher ist als normal.
In der Frage, wie viele Chemikalien existieren, die einen Einfluss auf das menschliche Hormonsystem haben, gehen die Positionen auseinander: Die Europäische Kommission listet zirka 500 Substanzen auf, für die es Hinweise auf eine hormonelle Aktivität gebe. Laut dem deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bedeutet eine solch blosse Listung jedoch nicht, dass alle diese Stoffe krank machen. Diverse Umweltverbände und Wissenschaftler gehen währenddessen von noch weit mehr verdächtigen Substanzen aus.
Manche Stoffe wie das halogenhaltige Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) sind inzwischen in der EU und der Schweiz verboten, andere unterliegen Beschränkungen. Die Europäische Kommission plant ausserdem weitere Regelungen für Spielzeug, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen, und neue Pestizide werden nicht zugelassen, wenn sie hormonell aktiv sind.
2018 gab die Europäische Kommission eine Richtlinie heraus, mit der die strittige Frage der Klassifizierung hormonell wirksamer Chemikalien geregelt werden soll. Gelistete Stoffe sind nunmehr zulassungspflichtig und können erst nach einer Risikobewertung in Umlauf gebracht werden. Die Regelung gehe nicht weit genug, kritisieren Experten und Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie: Es gebe zu viele Schlupflöcher, und die Hürden für ein Verbot seien zu hoch.
Wenn das Vorsorgeprinzip gilt, warum dauert es dann trotz diverser Verordnungen und Richtlinien von EU und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oft Jahre, bis wahrscheinlich krankmachende Stoffe aus dem Verkehr gezogen werden? Ein Grund liegt darin, dass viele dieser Chemikalien sehr unterschiedlich verwendbar und daher schwer zu ersetzen sind – und dass sich diverse Ersatzstoffe ebenfalls als risikoreich erwiesen haben.
Ein weiterer Grund liegt in der Schwierigkeit, die Gefährlichkeit der fraglichen Substanzen nachzuweisen. Bisherige Testverfahren sind langwierig, teuer und hochkompliziert. Wie können etwa Folgen abgeschätzt werden, die sich erst Jahre später zeigen? Wie werden Schäden bewertet, die sich womöglich bis in die nächste Generation auswirken? Mit Blick darauf sind Bewertung und Zulassung von neuen Tests für Chemikalien und Chemikalien-Gemische zurzeit auch ein Thema für die eben ausgeschütteten EU-Fördermittel unter dem Namen HORIZON 2020.
Bei den neuen Testverfahren spielen die Stoffkombinationen eine wichtige Rolle: «In Gemischen mit mehreren östrogen wirksamen Chemikalien ist die Gesamtwirkung höher, als wenn man die Wirkungen der einzelnen östrogenen Chemikalien addieren würde», sagt Dr. Schlumpf. «Das heisst, bei Gemischen aus Chemikalien, die alle die gleiche, z.B. östrogene Wirkung haben, ist das Risiko höher, als man es aufgrund der Konzentrationen der einzelnen Chemikalien erwarten würde.»
Weltweit forschen Toxikologen seit Jahrzehnten an endokrinen Disruptoren. In der Schweiz wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP 50) von 2000 bis 2007 in mehr als 30 Einzelprojekten die «Wirkung hormonaktiver Stoffe auf Mensch, Tier und Ökosystem» untersucht. Ein Ergebnis schlug damals besonders hohe Wellen: Die Spermienqualität der Schweizer Probanden liess zu wünschen übrig. Weitere Studien belegen, dass die Schweiz keine Ausnahme darstellt und die Anzahl fruchtbarer Spermien überall bei Männern in westlichen Gesellschaften zurückgeht. Als Ursache wurden unter anderem Umwelthormone ausgemacht.

Weniger Forellen in Bächen und Flüssen: Auch eine Folge von hohen Östrogenkonzentrationen in den Gewässern.
Solche Stoffe können auch in die Umwelt und in Gewässer gelangen und auf Wasserorganismen einen Effekt ausüben: Forscher beobachteten eine rückläufige Fortpflanzungsfähigkeit bei Wassertieren wie Fischen und Fischottern, Süsswasserschnecken und Wasservögeln. In der Schweiz wurde bereits in den 1980er-Jahren ein Rückgang der Fänge von Forellen in Bächen und Flüssen um 60 Prozent registriert. Auf der Suche nach den Ursachen initiierten 1998 die Forschungsanstalt Eawag und das Bundesamt für Umwelt zusammen mit Kantonen, Fischereiverband, chemischer Industrie und der Universität Bern das Projekt «Fischnetz». Hierbei wurde eine Kombination aus mehreren Ursachen festgestellt, zu denen auch östrogenaktive Stoffe gehörten. Beachtenswert war, dass in den Fliessgewässern nach Kläranlagen deutlich höhere Östrogenkonzentrationen gemessen wurden als davor. Damit stand fest, dass die Kläranlagen solche Verunreinigungen nicht genügend abbauen konnten.
Mittlerweile hat sich der Zustand vieler Schweizer Gewässer gebessert. Das liegt vor allem an dem Folgeprojekt «Strategie Micropoll», bei dem zusätzliche Reinigungsverfahren für Kläranlagen getestet wurden. Zwei Verfahren stellten sich als wirksam heraus und werden eingesetzt, sagt Dr. Eszter Simon vom Schweizerischen Zentrum für angewandte Ökotoxikologie, das an der Eawag und der EPFL angesiedelt ist. Für die kommenden Jahre sei geplant, weitere Kläranlagen damit nachzurüsten. Jedoch finden sich laut Dr. Simon im Abwasser lokal unterschiedliche Schadstoffgemische, so dass jede Kläranlage einzeln behandelt, geprüft und optimiert werden muss.
Hinzu kommt die Tatsache, dass immer wieder neue Chemikalien entwickelt werden, die über verschiedene Quellen in die Umwelt gelangen. Auch Pflanzenschutzmittel und Medikamente aus der Landwirtschaft, die nicht über die Kläranlagen in die Gewässer gelangen, spielen eine Rolle.
Es nütze nichts, nur Kläranlagen und landwirtschaftliche Aktivitäten zu überprüfen und zu regulieren. Es müsse auch die Zulassung neuer Chemikalien gut kontrolliert und beim Konsum umgedacht werden, sagt Dr. Simon und plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang: «Verbraucher können ihren Teil dazu beitragen, indem sie Medikamente und Chemikalien fachgerecht entsorgen und gut abbaubare Körperpflege- und Reinigungsprodukte verwenden.»
Wenn hormonaktive Stoffe von aussen in den Körper gelangen und dort das endokrine System stören können, wie wirken dann Pflanzenhormone, die sogenannten Phytohormone? Denn auch manche Pflanzen besitzen Inhaltsstoffe, die im Organismus eine hormonelle Wirkung entfalten können. Sie werden mit der Nahrung aufgenommen und sind vor allem in Soja und Rotklee, Leinsamen und Bohnen enthalten, auch in Sonnenblumen- und Kürbiskernen und in Heilpflanzen wie Traubensilberkerze, Salbei und Mönchspfeffer.
Laut dem deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) funktionieren diese natürlichen Hormone grundsätzlich so wie synthetisch hergestellte: Sie können an Rezeptoren andocken und die Wirkung von Hormonen verstärken oder abschwächen. Doch es gebe auch Unterschiede: Synthetische Hormone werden dem BfR zufolge langsamer abgebaut als natürliche, so dass die Verweilzeit im Körper länger sein kann. Ferner könnten Stoffwechselprodukte synthetischer Hormone eine andere Wirkstärke aufweisen als die Ausgangssubstanz, womit sie ein anderes Aktivitätsspektrum entfalten.

Tofu und Sojabohnen
Phytohormone gelten als sanfte Variante der Hormontherapie, weil sie regulierend auf den Hormonhaushalt wirken. Studien dazu kommen allerdings zu widersprüchlichen Ergebnissen. Beispielhaft dafür steht das östrogenähnliche Isoflavon, das reichlich in Soja vorhanden und gut untersucht ist: Die Beobachtung, dass Asiatinnen weniger Wechseljahrbeschwerden und Brustkrebs bekommen als Europäerinnen, stützte die Vermutung, ein ausgiebiger Sojakonsum könne eine schützende Wirkung haben. Studien mit Europäerinnen konnten diese Annahme jedoch nicht belegen. Möglicherweise spielen bei den Wechseljahren auch psychologische Faktoren aufgrund kultureller Unterschiede eine Rolle. Oder die Erklärung liegt darin, dass Asiatinnen schon in der Kindheit viel Soja essen, während europäische Frauen mit dem Verzehr von Isoflavonen erst in oder nach den Wechseljahren beginnen – und die Hormone oft nicht als Sojaprodukte, sondern in konzentrierter Form als Nahrungsergänzungsmittel konsumieren. Vielleicht gibt es noch ganz andere Erklärungen für Unterschiede bei der Wirkung von Phytohormonen. Eine relativ neue These bezieht sich auf die Darmflora: Das Mikrobiom verstoffwechselt viele Pflanzenhormone, und möglicherweise gibt es eine Verbindung zwischen der individuellen Bakterienbesiedelung im Darm, dem Stoffwechsel und dem Hormonsystem.
Von einer längerfristigen Einnahme von Phytohormonen in konzentrierter Form und Eigendosierung ohne ärztliche Verordnung rät das BfR ab. In Bezug auf pflanzliche Nahrung jedoch konstatierte die österreichische Endokrinologin Prof. Dr. Barbara Obermayer-Pietsch beim diesjährigen Kongress für Endokrinologie in Göttingen, dass der Anteil an Pflanzenhormonen und -mikroben, der mit der täglichen Nahrung aufgenommen werde, das Hormon- und Stoffwechselsystem entscheidend positiv beeinflussen könne. Daher solle eine gesunde Ernährung, wie seit vielen Jahren propagiert, grosse Anteile an Obst und Gemüse enthalten.