A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.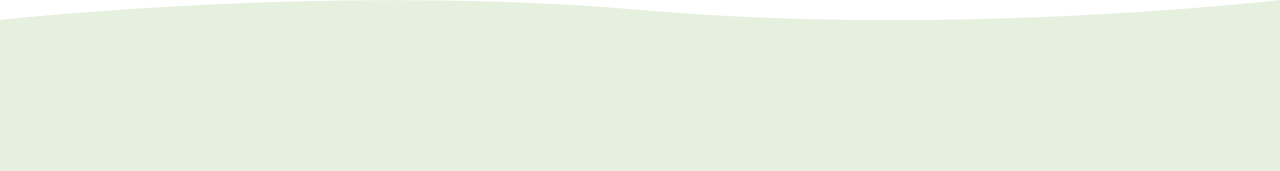
Leidige Verpackungen
Verpackungsmaterial ist nötig, aber nicht immer umweltfreundlich. Worüber man Bescheid wissen sollte.
Sie bieten Schutz, enthalten aber auch Schadstoffe: Tüten, Schachteln, Folien und Co. sind eine ökologische Herausforderung. Die Forschung tüftelt an umweltfreundlichen Alternativen, doch nicht jede Entwicklung ist tatsächlich nachhaltig.
Autor: Tino Richter, 09.18
Verpackungen sind notwendig, keine Frage. Sie schützen unsere Lebensmittel, erhöhen die Haltbarkeit und reduzieren die Keimbelastung. Dass Bio-Gemüse allein deshalb verpackt sein muss, um es von herkömmlichem unterscheiden zu können, ist jedoch keine gute Entwicklung. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) sind 63 Prozent des Frischgemüses bzw. Obstes im Supermarkt vorverpackt, mit steigender Tendenz. 6300 Millionen Tonnen Plastikmüll soll die Menschheit laut Science Advances bereits produziert haben. Fast 80 Prozent davon lagern auf Deponien oder sind in die Umwelt gelangt. Nicht einmal ein Zehntel dieser Materialien wurden bisher recycelt. Und jedes Jahr gelangen allein in der EU fast 50 Millionen Tonnen Plastik zusätzlich in den Verkauf, von denen wiederum nur zwei bis drei Millionen wiederaufbereitet werden. Keine Frage, mit dem globalen Austausch von Waren hat sich die Menschheit ein ernstes Problem geschaffen. Jede siebte Essensverpackung weist giftige Rückstände auf, oft gerade, weil sie aus Recyclingmaterial wie Zeitungspapier besteht, das mit Farbe aus Mineralöl bedruckt ist.
Chemische Verbindungen, die nicht ins Essen gehören, stammen zu einem Grossteil aus Verpackungen. Das Kantonale Labor Zürich zur Überwachung der Lebensmittelsicherheit schätzt, dass etwa 100 000 Substanzen aus Verpackungen in Lebensmittel übergehen können. Und viele davon sind gar nicht bekannt. Eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit bestehe zwar nicht, so das Labor. Jedoch könnten chronische Beschwerden entstehen, und in der Forschung werden diese Stoffe mit der Abnahme männlicher Fruchtbarkeit und der Zunahme von Brustkrebsfällen bei Frauen in Zusammenhang gebracht. Der Weichmacher Bisphenol A (BPA) wurde weitgehend aus Trinkflaschen verbannt, doch wird er weiterhin in Beschichtungen von Konserven- und Getränkedosen sowie in gewissen Lebensmittelverpackungen verwendet, auch im Dichtungsring (ausser, wenn dieser blau ist) der Deckel von Glasbehältern ist er zu finden. Besonders bei ölhaltigen Lebensmitteln wie Pesto werden die Grenzwerte für Weichmacher in Deckeln teilweise deutlich überschritten.

Am Anfang aller Kunststoffverpackungen stand Cellulose, Ausgangsstoff für das Verpackungsmaterial Zellophan. Erst danach wurde das günstigere Mineralöl zur Grundlage für die heute gebräuchlichen Kunststoffe wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC).
Das zweite grosse Problem von Kunststoffen: Sie gelangen über den Abfall in die Umwelt. Eine Plastikflasche braucht schätzungsweise bis zu 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Wobei ein vollständiger Abbau unwahrscheinlich ist, die Produkte werden durch Wärme, Wasser und UV-Strahlung nur immer kleiner, zu sogenanntem Mikroplastik. In den 80er-Jahren kamen andere Kunststoffe hinzu, welche die Abhängigkeit vom Erdöl reduzierten sollten. Die Industrie setzte fortan auf nachwachsende Rohstoffe wie Stärke aus Zuckerrüben und Mais sowie Zellulose aus Holz. In der Folge entstanden Kunststoffe wie Polylactide (PA), Polyhydroxyalkanoate (PHA) oder Mater-Bi, die unter bestimmten Bedingungen auch biologisch abbaubar sein sollte.
Doch der Euphorie um biologisch abbaubare Kunststoffe folgte Ernüchterung. Denn nicht jeder Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen ist kompostierbar. Und nicht alle biologisch abbaubaren Kunststoffe sind aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das sorgt bei Konsumenten bis heute für Verwirrung und macht die sogenannten Biokunststoffe alles andere als ökologisch. Denn die Verrottung von Tüten aus biologisch abbaubarem Material braucht sehr lange, länger als für städtische Kompostieranlagen vorgesehen ist. Die Folge ist, dass «Biomüllbeutel» meist aussortiert und schliesslich verbrannt werden. Zudem können die automatisierten Sortieranlagen ohnehin meist nicht zwischen Biotüte und normaler Tüte unterscheiden. Wer es genau wissen will, sollte mit dem kommunalen Müllentsorgungsamt sprechen und explizit nachfragen. Beim Abbau bilden Biokunststoffe zudem keine wertvollen Bodenbestandteile, sie fördern vielmehr die Versauerung der Böden.

Hinzu kommt, dass Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen bindet und damit die Ökobilanz verschlechtert. Die Verpackung selbst macht nur maximal zehn Prozent der Umweltbelastung aus. Aus diesem Grund sind Biokunststoffe meist nicht besser oder teilweise sogar schlechter als herkömmliche aus Erdöl. Zwar enthalten die Biovarianten reiner Form weniger gesundheitsschädigende Zusatzstoffe, den Meereslebewesen hilft das aber nicht. Sie können aufgrund des langen Abbauvorgangs auch an einer Biotüte verenden. Der Anteil von biologisch abbaubaren Werkstoffen liegt in der Schweiz deutlich unter 0,1 Prozent, was den Aufwand für die Kompostierung wirtschaftlich unrentabel macht.
Was also tun mit dem Verpackungsproblem? Eine einfache Antwort darauf gibt es sicher nicht, aber Recycling und Vermeidung von Verpackungsmüll sind zwei entscheidende Punkte für die zukünftige Entwicklung. Können Papier und Glas bis zu 80 Prozent wiederverwertet werden, liegt die Quote bei Kunststoffen sehr viel tiefer. Zu gross sind die Anforderungen an die Industrieanlagen für die unterschiedlichen Plastik-Arten. Während es für PET-Getränkeflaschen sowie für die Milch- und Waschmittelflaschen (meist aus PE) in Deutschland ein gut funktionierendes Sammelsystem gibt, werden alle anderen Kunststoffe in ein und demselben Sack vermengt. Dadurch vermindert sich die Qualität der zu recycelnden Rohstoffe. Theoretisch müsste für jeden Kunststoff eine separate Sammlung vollzogen werden. Dieser Aufwand steht aber im grossen Gegensatz zum Energie-Einsatz, der allein für die Herstellung des Produkts benötigt wurde.
Die gesetzliche Recyclingquote liegt in Deutschland deshalb auch nur bei 36 Prozent, wobei laut der Zeitschrift Ökotest bis zu 65 Prozent machbar wären. In der Schweiz wurden laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) 70 Prozent als Ziel gesetzt, allerdings beruht die Vereinbarung auf Freiwilligkeit. Hier werden bisher nur 8 Prozent des Abfalls stofflich verwertet, der Rest gelangt in Verbrennungsanlagen.
Wer was wie recyceln darf, führt zu Kompetenzgerangel zwischen Verbänden, Gemeinden und Unternehmen. Denn die Müllentsorgung ist auch ein grosses Geschäft, um die Verbrennungsanlagen auszulasten. Betrachtet man den Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung, den Transport bis zur Entsorgung von Kunststoffen, ist die Verbrennung gemessen am Verbrauch von Energie und Rohstoffen sowie am Ausstoss schädlicher Stoffe in Luft, Wasser und Boden bei allen anderen Plastikarten leider immer noch die ökologisch bessere Variante, wenn sich nicht grundlegend etwas ändert. Die EU plant, in den nächsten Jahren Wegwerfartikel aus Plastik grösstenteils zu verbieten. In zwölf Jahren sollen alle Kunststoffverpackungen zudem recycelbar sein.
Die Alternativen sind noch nicht so weit entwickelt, trotz vielversprechender Forschungsansätze. Einer davon wird von Prof. Andrea Kruse, Leiterin am Institut für Agrartechnik im Fachgebiet Konversionstechnologien nachwachsender Rohstoffe an der Uni Hohenheim, verfolgt. Jedes Jahr fallen in Europa rund 500 000 Tonnen Chicoréeabfall an, denn die Wurzelknolle der Pflanze ist aufgrund der Bitterkeit nicht für den Verzehr geeignet. Doch der darin enthaltene Speicherstoff Inulin lässt sich über Zwischenstufen zu dem Polyester Polyethylenfuranoat (PEF) umwandeln, welches eine ähnliche Struktur wie PET aufweist.
Zusätzlich kann er auch zu Nylon (Polyamid) weiterverarbeitet werden. Mit der anfallenden Menge an Chicorée liessen sich so rund drei Milliarden Nylonstrumpfhosen herstellen. Zwar sind die aus Chicorée gewonnenen Stoffe nicht kompostierbar, dafür lassen sie sich «mit den derzeit üblichen Trenn-, Säuberungs- und Umformverfahren» bis zu sechsmal wiederverwerten, erklärt die Expertin.

Kompostierbare Kunststoffe sind laut Prof. Andrea Kruse keine Alternative: «Wir stellen keine biologisch abbaubaren Kunststoffe her, weil sie unserer Meinung nach nicht nachhaltig sind. Sie können nur einmal verwendet werden. Relativ zu dem Aufwand, der für die Herstellung der Verpackung notwendig ist, ist Kompostierung keine angemessene Nutzung.»
Im Gegensatz zu vielen anderen Verpackungsmaterialien werden beim Chicoréeprodukt keine weiteren fossilen Zusatzstoffe benötigt. «Wir gehen von einem sogenannten On-Farm-Konzept aus: Kleinen, dezentralen Biogasanlagen, die für den Verarbeitungsprozess Wärme und Strom produzieren. Diese Anlagen werden mit den Resten der nicht verarbeiteten Biomasse betrieben. Die Nährstoffe aus den Chicoréeresten landen letztlich wieder auf dem Feld», so Andrea Kruse weiter.
Statt Rohstoffe extra für die Verpackungsindustrie anzubauen, wird pflanzlicher Abfall als Grundlage verwendet und zugleich energetisch verwertet.
Andere Ansätze sind bereits auf dem Markt: Julian Lechner sammelt mit seinem Start-up-Unternehmen «Kaffeeform» den bei der Kaffeezubereitung anfallenden Kaffeesatz, um ihn zusammen mit weiteren Biopolymeren, Stärke, Cellulose, Holz, Naturharzen, Wachsen und Ölen zu einem neuen Verbundwerkstoff zusammenzusetzen. Aus dem Material lassen sich wieder neue Dinge herstellen oder sie können in einer industriellen Kompostieranlage zersetzt bzw. CO2-neutral verbrannt werden.

Wie wär's mit einer aus Algen gefertigten Membran als Glasersatz? «Ooho!» ist laut dem britischen Hersteller eine zu 100 Prozent pflanzliche Hülle, die sich innerhalb von vier bis sechs Wochen selbst abbaut und zudem essbar ist. Sie verbraucht fünfmal weniger CO2 und neunmal weniger Energie als PET-Flaschen. Das Wasser befindet sich in kleinen Säckchen, die man aussaugt. Leider ist die Membran deutlich weniger stabil als Glas, so dass sie beim Transport zerplatzen würde. Das ist zwar wenig praxistauglich, und die Algen müssten hierfür auch extra gezüchtet werden, aber vielleicht bedarf es in Zukunft auch einfach nur eines neuen Verständnisses vom Trinken ohne Glas.
All diese Ansätze und Verbrauchertipps machen zwar Hoffnung, täuschen aber nicht darüber hinweg, dass wir ohne globale Initiativen für Müllvermeidung und Recycling diesem Planeten über Jahrzehnte hinaus noch mehr Plastik zumuten werden. Der Trend zum Unverpackt-Laden hat zwar auch die Schweiz erreicht, doch das scheint bestenfalls auf lokaler Ebene für haltbare Lebensmittel wie Pasta oder Hülsenfrüchte sowie frisches Gemüse eine Möglichkeit.

Die Paprika aus Spanien, Heidelbeeren aus Polen oder der Rucola aus der Region werden wohl auch in Zukunft eine Verpackung benötigen, damit die Produkte frisch bleiben und es sich für die Hersteller wirtschaftlich rechnet. Warum nicht, wie es die EU vorhat, stärker das Verursacherprinzip anwenden? Wer viel Verpackungsmaterial nutzt, muss auch bei der Beseitigung stärker mithelfen.
Verpackungen vermeiden
- Verpackungen vermeiden
- unverpackte Ware kaufen
- lokales, saisonales Gemüse/Obst kaufen
- Mehrwegflaschen nutzen
- auf Plastikgeschirr verzichten
- eigenen Einkaufsbeutel mitnehmen
- keine Coffee-to-go-Becher nutzen
- Joghurt aus Gläsern statt Bechern nehmen
- Käse an der Frischetheke kaufen statt abgepackt
- selbst kochen statt Fertiggerichte kaufen
- Wachstuch statt Plastikfolie zum Abdecken verwenden
- Wasser aus der Leitung trinken statt aus Plastikflaschen
- Grünabfälle in Papier wickeln statt in eine Bioplastiktüte
- Getränkekartons meiden
- Altpapier sammeln


