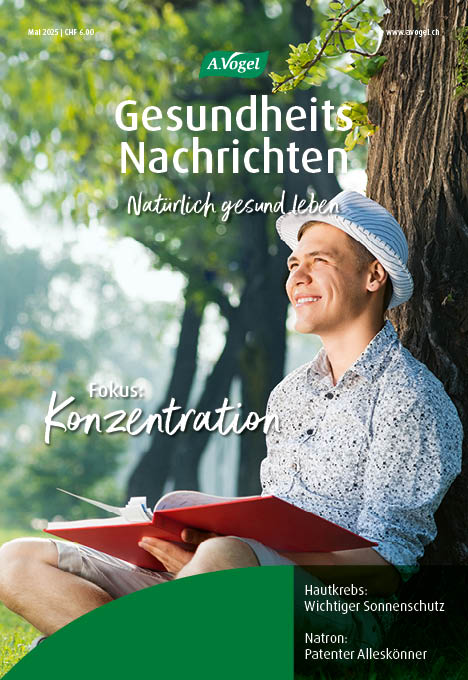A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.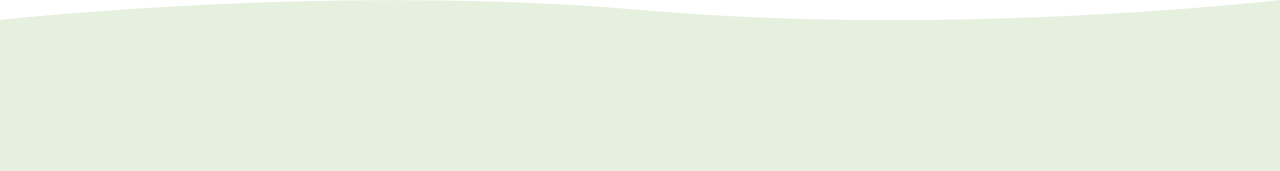
Bionik – Natur clever kopiert
Abschauen von der Umwelt, um Lösungen für den Alltag zu finden: Damit beschäftigt sich die Bionik. Einblick in eine spannende Wissenschaft.
Autorin: Gisela Dürselen, 07/20
Als Leonardo da Vinci seine Fluggeräte entwarf, beobachtete er wie Vögel fliegen. Dann abstrahierte er und baute seine Konstruktionen. Der italienische Universalgelehrte gilt als Vorreiter der Bionik, weil er wie die heutigen Bionik-Wissenschaftler Biologie mit Technik kombinierte, von der Natur lernte und damit etwas grundlegend Neues erschuf. Heute spielt Bionik auf vielen Gebieten eine Rolle, z.B. in der Architektur, in der Automobil- und Luftfahrttechnik und in der Medizin.
Wer sich mit der Geschichte bionischer Produkte beschäftigt, kommt an Stacheldraht, Klettverschluss und Lotuseffekt nicht vorbei, denn alle drei sind Paradebeispiele für das Vorbild Natur.

Der Klettverschluss geht auf das Prinzip der winzigen Häckchen an den Früchten der Grossen Klette (Arcticum lappa) zurück.
Der Stacheldraht wurde in den USA der 1870er-Jahre erfunden, und der amerikanische Osagedorn-Strauch stand Modell. Der Klettverschluss imitiert den Haftmechanismus von Klettenpflanzen. 1951 meldete ihn der Schweizer Ingenieur George de Mestral zum Patent an.
Den selbstreinigenden Lotuseffekt gibt es unter anderem bei Wandfarben. Wie der Name besagt, stand die Lotosblume Modell, denn auf ihren Blättern perlt das Wasser samt Schmutzpartikeln ab.
Als erstes Bionikpatent Deutschlands gilt ein Streuer von 1920: Er war den Kapseln der Mohnblume nachempfunden und war dazu gedacht, Versuchsschälchen mit Mikroorganismen zu beimpfen, die möglichst gleichmässig verteilt werden.
Ein Merkmal der bionischen Methode ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Denn die Erforschung natürlicher Prinzipien, ihre Abstraktion und Umsetzung in die technische Praxis verlangen Kenntnisse von Biologen und Ingenieuren – und je nach Thema auch die Mitwirkung weiterer Disziplinen. Dabei gibt es zwei Methoden des Arbeitens: Die Wissenschaftler betreiben entweder Grundlagenforschung – eine breitgestreute Suche nach generell interessanten Phänomenen in der Natur – oder es besteht ein Problem und für dieses wird nach konkreten Antworten in der Natur gesucht. Bis eine gezielte Suche in ein fertiges Produkt mündet, dauert es im Schnitt drei Jahre, sagt Prof. Dr. Thomas Speck, Biophysiker und Direktor des Botanischen Gartens der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Fünf bis sieben Jahre dauere es bis zur Marktreife einer Idee.

Studien von Prof. Speck und seinem Team zum Hebelmechanismus der Wiesensalbeipflanze sind ein Beispiel für Grundlagenforschung: Beim Wiesensalbei drücken Insekten auf einen Hebel in den Blüten, um an den Nektar zu gelangen. Dadurch senkt sich der Staubbeutelarm mit seinen Pollen auf den Rücken des Insekts. Interessant für die Wissenschaft war die Aufhängung des Hebels. Denn dieser ist nicht an einem Scharniergelenk, sondern an einem Bändchen befestigt, was laut Prof. Speck mehrere Vorteile bietet. Zum einen sei das Bändchen robuster als ein Gelenk, denn «je kleiner das Gelenk, desto grösser die Gefahr, dass es sich verklemmt». Zum anderen erlaube das Bändchen mehr Flexibilität als ein starres Gelenk; so sei bei Wasserstress der Hebelmechanismus leichter auszulösen als sonst. Welche Funktion dies für die Pflanzen hat, ist Prof. Speck zufolge noch nicht geklärt, aber in der bionischen Umsetzung könne so die Auslösekraft reguliert werden. Noch existiert kein fertiges Produkt, das auf diesem Wissen beruht. Doch Prof. Speck sieht das Potenzial für die Konstruktion von beweglichen Instrumenten, die an ihrem Ende einen Druckpunkt besitzen. Solche Instrumente in Miniaturform würden in der minimalinvasiven Chirurgie benötigt, die sich auf kleinste Schnitte und Eingriffe in den Körper beschränkt.
Die Chirurgie ist ein wichtiges Einsatzgebiet für die Medizin-Bionik. Die Erfindungen reichen von der Injektionsnadel, die vom Giftstachel der Biene inspiriert wurde, bis hin zum Knochenbohrer für Hüftgelenksoperationen, der nach dem Vorbild der Holzwespe bohrt. Auch bei der Suche nach haltbaren und bioverträglichen Materialien, etwa für Implantate und Gewebekleber, werden Forscher in der Natur fündig. So wie das Team um Claudio Toncelli an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in St. Gallen: Die Bioniker wollten einen Gewebekleber herstellen, der elastisch und bioverträglich ist und der am schlagenden Herzen haftet. Denn wenn Herzmuskelgewebe etwa aufgrund eines Infarkts beschädigt ist, muss es so schnell wie möglich instandgesetzt werden.
Als Grundlage für den Kleber bot sich Kollagen an, denn dieses ist ein wichtiger Eiweissbaustoff im Körper und unter anderem an der Wundheilung beteiligt. Um Wunden an inneren Organen zusammenzuhalten, musste das Kollagen allerdings noch mit einer weiteren Substanz stabilisiert werden. Das Modell für die gesuchte Substanz boten Meeresmuscheln. Denn diese produzieren mit ihren Drüsen sogenannte Muschelseide: Haltefäden, die so kräftig sind, dass sich die Muscheln unter Wasser und bei widrigsten Bedingungen wie Wind und hohem Wellengang an Felsen, Booten und Kaimauern anhaften können. In der Folge produzierten die Forscher chemische Verbindungen, die jenen der Muschelseide ähneln, und stabilisierten damit das Kollagen. Laborexperimenten zufolge ist der so produzierte Herzkleber gewebeverträglich und hält auch dem menschlichen Blutdruck stand; es fehlen nur noch die klinischen Studien.
Neben solch technischen Lösungen, die sich an der Natur orientieren, zählen zur Bionik laut Prof. Dr. Robert Riener von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich auch «Fusionen von Natur und Technik oder Mensch und Technik». Zu den Kombinationen zwischen Mensch und Technik gehört die Prothetik, durch die menschliche Gliedmassen und auch Sinnesorgane wie das Gehör ersetzt werden können, sowie alle Formen von Geh- und Bewegungshilfen. «Unter bionischen Prothesen versteht man zumeist Prothesen, die elektronisch mit dem Körper, konkret mit dem Nervensystem des Benutzers, verbunden sind», erklärt Prof. Riener. Im Labor werde bereits an «fühlenden Prothesen» gearbeitet: Bei diesen könnten Elektroden, die im Körper implantiert sind, motorische wie auch sensorische Nervenfasern stimulieren.
Prof. Riener arbeitet mit seinem Team an sogenannten Exomuskeln zur Unterstützung von Menschen mit Muskelschwäche oder Lähmungen sowie an sogenannten Exoskeletten, also mechanischen Stützstrukturen, die gelähmten Menschen das Gehen ermöglichen. Das Vorbild für die Exoskelette lieferte die Natur, denn im Tierreich verfügen Gliederfüsser über kein Innenskelett, dafür aber über ein gepanzertes Aussenskelett.
2016 kam Prof. Riener auf die Idee, einen sportlichen Wettkampf zu organisieren, bei dem es nicht um ein Höher, Schneller und Weiter geht, sondern um all-agsrelevante Aufgaben wie Treppensteigen und Wäscheaufhängen. So sollte die grosse Bandbreite der Assistenzgeräte einem Praxistest unterzogen werden. Der «Cybathlon», bei dem Menschen mit Behinderungen mit ihren jeweiligen Assistenzgeräten gegeneinander antraten, erfuhr grossen internationalen Zuspruch und soll deshalb eine Neuauflage erhalten.
Viele bionische Erfindungen für die Medizin sind trotzdem eher Nischenprodukte, zwar vielversprechend und das Leben für einen bestimmten Kreis der Bevölkerung enorm erleichternd, jedoch keine Massenartikel. Gleichwohl hat Bionik das Potenzial, auch das Leben von vielen zu verändern.
Nachhaltigkeit zählt zu den grossen Versprechen der Bionik. Denn Einfachheit und Effizienz gehören zu den wichtigsten Erfolgsprinzipien der Entwicklungsgeschichte: Biologische Systeme erhalten sich selbst und sind multifunktional, Ressourcen werden optimal genutzt, und anstelle von Abfall gibt es nur Rohstoffe, die in umgewandelter Form für ständig neue Prozesse zur Verfügung stehen. Die Frage lautet somit: Wie können solche Prinzipien auf die Technik und vielleicht sogar auf Wirtschaft und Gesellschaft übertragen werden?
® Foto: ITKE, Universität Stuttgart
In der Tat zeichnen sich viele bionische Erfindungen durch eine hohe Energie- und Ressourceneffizienz aus, etwa für Automobil und Luftfahrt in Form von neuen Werkstoffen, die den Treibstoffverbrauch senken oder mit Leichtbaumethoden und Designs in der Architektur, die Material einsparen und ein angenehmes Wohnklima erzeugen, oder mit Baustoffen, die sich selbst reparieren und Alltagsprodukten ein langes Leben verleihen, und nicht zuletzt mit Ideen wie dem Fassaden-Beschattungssystem, das Prof. Speck mit Kollegen entwickelte und das die Ökobilanz von Gebäuden verbessert. Auch eine Kreislaufwirtschaft, die sich an den Kreisprozessen in der Natur orientiert, sowie umweltschonende Produktionsprozesse können mithilfe von Bionik entstehen. Insgesamt, so lautet eine Schätzung der in Berlin ansässigen Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetzwerk e.V. (Biokon), könnte Bionik bis zum Jahr 2030 weltweit 500 000 Millionen US-Dollar zur Ressourceneinsparung beitragen.
Ist Bionik damit per se nachhaltiger und umweltfreundlicher als konventionelle Technik? «Nein», sagt Prof. Speck. Bionische Produkte und Prozesse seien nicht automatisch besser als andere. Mit den Prinzipien «möglichst wenig Material, möglichst wenig Energie» sei das Nachhaltigkeitspotenzial zwar gross – dennoch müsse jeder Einzelfall getestet werden.
Denn Bionik kann auch Risiken bergen, wie das Beispiel der Nanobionik zeigt. Dieser Teilbereich der Bionik versucht, die evolutiven Prozesse zu verstehen und zugleich darin einzugreifen – etwa, indem Forscher Gene verändern, wie dies Nanobioniker aus Massachusetts getan und so Pflanzen zu Lichtquellen umgewandelt haben. Ein weiteres Handicap für die Nachhaltigkeit liegt aus Sicht von Prof. Speck in der Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der bionisch-nachhaltigen Erfindungen auf den Markt kommt. Schlicht aufgrund der Tatsache, dass die Eigenschaft der Nachhaltigkeit allein oft nicht genügt, um das Interesse von Firmen zu wecken. Hier brauche es einen «Nachhaltigkeitsdruck», sagt Prof. Speck, «den Druck auf Unternehmen, etwas zu ändern».