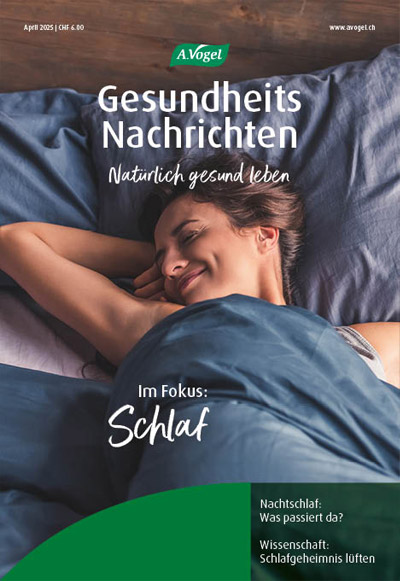A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.
Zwitschernde Natur-Uhr
Welcher Vogel um welche Uhrzeit seinen Gesang anstimmt.
Im Frühling und Sommer könnte man glatt auf den Wecker verzichten. Denn die Vögel stimmen ihren Gesang zu ganz bestimmten Uhrzeiten an. Hören Sie mal hin!
Autor: Heinz Scholz
Die meisten Singvögel sind echte Frühaufsteher. Sie beginnen mit ihrem Gesang bereits vor Sonnenaufgang. Jede Vogelart hat einen anderen Zeitpunkt für den morgendlichen Gesangsbeginn. Mithilfe einer Vogeluhr ist eine grobe Schätzung der Uhrzeit möglich, zu der die jeweiligen Exemplare mit dem Tirilieren beginnen. Der Gesang ist abhängig von der Vogelart, von der Umgebungshelligkeit, vom Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, vom Wetter, von Begleitgeräuschen, von der Region und vom Lebensraum. So beginnen die Vögel mit ihren Gesängen im Osten aufgrund des früheren Sonnenaufgangs zeitiger als Artgenossen im Westen. Schreitet das Frühjahr fort, verlagert sich der Gesangsbeginn in immer frühere Morgenstunden. Die innere Uhr der Vögel kann jedoch durcheinandergeraten. So liess an warmen Tagen (15 °C!) im November 2020 eine Amsel ihren Gesang ertönen. «Es kommt durchaus vor, dass Vögel auch im Winter singen, wenn sie genügend Energie haben. Beim Rotkehlchen ist das sogar normal, es verteidigt auch im Winter ein Revier», informiert Livio Rey, Biologe der Vogelwarte Sempach.
Der Hausrotschwanz ist ein Top-Frühaufsteher und als einer der ersten vor Sonnenaufgang zu hören. Man solle die Angaben zur Vogeluhr jedoch mit einiger Vorsicht interpretieren, gibt Livio Rey zu bedenken. Die ungefähren Angaben stimmen. Allerdings gibt es immer wieder Vögel, die früher oder später zu hören sind als in der Vogeluhr angegeben. Nach den ersten Sängern stimmen Singdrossel, Amsel, Rotkehlchen, Stieglitz, Zaunkönig, Buchfink, Blaumeise, Zilpzalp, Star und die Kohlmeise in den Morgenchor ein. Und was ist mit den Spatzen? Die geselligen Vögel sind Langschläfer. Sie beginnen mit ihrem Tschilpen später. Auch Mönchsgrasmücke (+5 Minuten), Distel- (+15 Minuten) und Grünfink (+30 Minuten) sind erst nach Sonnenaufgang zu hören.
Die vielfach als Sinnbild für Frühaufsteher gehandelte Lerche reiht sich zwischen Rotkehlchen und Zaunkönig ein, sie fängt etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang an.

Die in der Tabelle angezeigten Zeiten der Vogeluhr gelten für das Schweizer Mittelland. Sie stammen aus dem Themenheft «Vogelstimmen» der schweizerischen Vogelwarte Sempach. Autor Christian Marti ist Biologe.
Der Gesang ist zum Teil angeboren. Das erforschte man bei isoliert aufgezogenen Vögeln. Wiederum «erlauschen» Jungvögel aber auch ihr Repertoire. Amseln z.B. übernehmen die Gesangselemente vom Vater und von anderen Männchen. Interessanterweise werden die Gesangskünste auch von Zivilisationsgeräuschen (Sirenengeheul, Martinshorn, Handytöne) beeinflusst. Ein Forscherteam der Universität Zürich um Gilberto Pasinelli konnte nachweisen, dass Rohrammern flexibel auf Umgebungsbedingungen reagieren. «An Wochentagen sangen Männchen im Bereich von lärmigen Strassen höher und seltener als an Wochenenden, wenn das Verkehrsaufkommen gering war.» Wurde ihnen Verkehrslärm vorgespielt, änderten sie auch die Anzahl der Strophen pro Minute. Sie passen sich der Zivilisation an. Allerdings paaren sich in lärmigen Gegenden die Männchen weniger als in ruhigen Gegenden. Lärm hat also einen erheblichen Einfluss auf das Paarungsverhalten und kann den Bruterfolg senken.
Die Vogelmännchen singen, um gegenüber fremden Vögeln gleichen Geschlechts ihr Brutrevier abzugrenzen und zu verteidigen. Ein lediges Tier wird versuchen, ein Weibchen anzulocken. Vielleicht spielen auch die besten Gesangskünste bei der Partnerwahl eine Rolle – wer gut singt, bekommt schneller ein Weibchen. Die Gesangsaktivität wird übrigens von den Keimdrüsen gesteuert.
ANZEIGE
Bestimmte Vogelarten derselben Art singen innerhalb eines Landes Dialekte. Die Unterschiede sind mitunter gut zu erkennen oder durch Aufzeichnungen von Schallereignissen mittels Sonograf nachzuweisen. Gesangsdialekte sind bei der Goldammer in Europa belegt. «In Mitteleuropa bleiben sie auf gleicher Tonhöhe, in Dänemark und der Schweiz fallen sie sirenenartig ab und in Südosteuropa sind sie leicht ansteigend», vermerkt Wikipedia. Doch sogar für Experten ist das Erkennen von Vogelstimmen nicht immer leicht: So lockt ein Buchfink in Basel sein Weibchen mit einem anderen Ruf als in der Innerschweiz. Meisen wiederum geben in der Stadt lautere und höhere Töne von sich als in ländlichen Gebieten. Manche Vogelarten imitieren andere Vögel oder Umgebungsgeräusche. Stare etwa zwitschern gerne wie Pirole, Spatzen oder Grauspechte. Eine Amsel, die neben einer Pferdeweide singt, beendete ihre Rufe oft deutlich mit einem «Wiehern», beobachteten Forscher.
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife unterstützen Interessierte, die lernen möchten, Vogelstimmen zu erkennen. Sie bieten Kurse, Wanderungen, Apps und weitere Infos an. Die Vogelstimmen-Wanderungen des NABU sind nichts für Morgenmuffel: Sie beginnen kurz vor Sonnenaufgang. Denn in dieser Zeit trällern die gefiederten Sänger am intensivsten. Schlau machen kann man sich dank NABU auch im Internet, anhand der Vogeluhr mit «Stimmproben». Mittels Anklicken des jeweiligen Vogels ist der dazugehörige Gesang zu hören. Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife bietet u.a. Bergvogelexkursionen, Infos über Vögel und botanische Grundkurse an.
Weitere Infos: