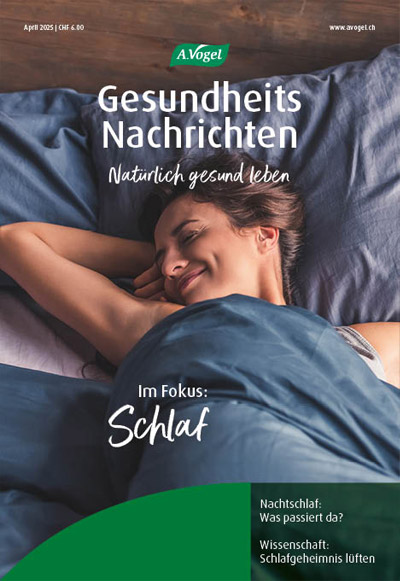A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.
Häufig kalte Füsse – typisch Frau?
Woher das Frösteln an den unteren Extremitäten kommt, was dagegen hilft und wann man sich ärztlichen Rat holen sollte.
Text: Andrea Pauli
- Unterschiedliches Kälteempfinden
- Harmlos: Wärme-Kälte-Ausgleich
- Vermeidbar: falsches Schuhwerk
- Abzuklären: krankheitsbedingte Ursachen
- Selten im Blick: der Vagusnerv
- Auf der richtigen Spur: Diagnose
- Wann zum Arzt?
- Tipps gegen kalte Füsse
- Was tun bei kalten Babyfüssen?
- Warum wir mit kalten Füssen schlecht einschlafen
Dicke Kuschelsocken. Wärmflasche. Kirschkernkissen. Fellgefütterte Finken. Frauen werden wissend nicken, Männer vermutlich seufzend die Augen verdrehen: Wenn es ums Stichwort «kalte Füsse» respektive Massnahmen dagegen geht, tut sich offenbar ein Geschlechtergraben auf. Tatsächlich? Fakt ist: Der Frauenkörper «tickt» anders, was Wärme und Kälte angeht. Muskeln sind quasi die Wärmefabrik im Körper – und Frauen haben nun mal eine geringere Muskelmasse als Männer. Das führt zu einem niedrigeren Grundumsatz und damit einer geringeren Wärmeproduktion pro Kilogramm Körpergewicht. Was bedeutet: Frauen empfinden kühlere Temperaturen schneller «kalt» als Männer dies tun. Zudem haben Frauen eine um rund 15 Prozent dünnere Haut; dadurch kühlen sie schneller aus. Des Weiteren haben Frauen häufiger einen tiefen Blutdruck, weshalb das Blut schwerer in die feinen Blutgefässe der Füsse (und Hände) gelangt.
Nur im Frau-Mann-Schema denken sollte man in puncto kalte Füsse nun aber auch nicht. Die Auslöser für ein Kälteempfinden an den Füssen sind mannigfaltig und so individuell wie die Menschen selbst», betont Dr. med. Kerstin Schick, Fachärztin für Gefässchirurgie und Phlebologie. «Daher lässt sich auf die Frage nach der Ursache keine Antwort geben, die für jede Frau und für jede Situation pauschal passt.» Sie plädiert darum für eine sorgfältige Diagnostik, wenn Frauen häufig oder ständig unter kalten Füssen leiden.
«Eine grosse Rolle spielt die Umgebungstemperatur. Damit die zentralen Organe des Körpers problemlos funktionieren, muss die Körperkerntemperatur bei etwa 37 °C liegen. Sinkt die Umgebungstemperatur, verengen sich die peripheren Gefässe der Gliedmassen, damit alle Wärme im Zentrum des Körpers verbleibt, wo sie zur Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen gebraucht wird. Die Füsse können auf unter 10 °C abkühlen und tun trotzdem noch brav ihren Dienst», erläutert die Fachärztin.
Entsprechend sei ungemütliches, frostiges Wetter eine häufige Ursache für ein ausgeprägtes Kälteempfinden – vor allem in Kombination mit nicht ausreichend warmem Schuhwerk oder feuchten Füssen, so Dr. Schick. Viele Frauen tragen jedoch gerne mal Schuhe, die der Witterung nicht unbedingt angepasst und obendrein viel zu eng sind. Diese Enge bewirkt, dass die kleinsten Blutgefässe abgedrückt werden; das führt wiederum zu eingeschränkter Durchblutung. In engen Schuhen fehlt obendrein die Luftschicht, die entscheidend zur Isolierung beiträgt. Die einfachste Massnahme bei kalten Füssen ist also: besseres Schuhwerk wählen.

- Gefässerkrankungen wie die Gefässwandverkalkung (Arteriosklerose) können eine Ursache für kalte Füsse sein. Wer davon betroffen ist, hat zudem schmerzende Beine beim Gehen.
- Massgeblichen Einfluss auf die Wärmeregulation des Körpers können auch hormonelle Störungen haben, z. B. eine Schilddrüsenunterfunktion.
- Auch das weibliche Geschlechtshormon Östrogen wirkt sich bisweilen auf die Körpertemperatur aus und kann die Durchblutung an Füssen (und Händen) beeinträchtigen.
- Kalte Füsse können ein Hinweis auf Durchblutungsstörungen der Extremitäten (periphere arterielle Verschlusskrankheit, PAVK), Herzerkrankungen, Blutarmut oder das Raynaud-Syndrom sein. Eine Minderdurchblutung kann auch auf Diabetes, Herz-Lungen-Krankheiten, ein Fibromyalgiesyndrom oder eine Magersucht hinweisen.
- Verstärktes Kälteempfinden tritt gerne mal bei einem Mangel an Vitamin D, Magnesium, Kalium oder Eisen auf.
- Die Einnahme spezieller Medikamente (Antibabypille, Antidepressiva, Diuretika, Arzneien gegen Bluthochdruck, Migränemittel [Ergotamine]) kann sich auf das vegetative Nervensystem auswirken, Gefässengstellungen verursachen und so ein Kälteempfinden der Füsse verstärken.
- Frösteln lassen können einem psychische Beeinträchtigungen, z.B. Depressionen oder Angstzustände. «Nicht umsonst heisst es, dass man ‘kalte Füsse’ bekommt, wenn die Angst in einem aufsteigt», so Dr. Schick.
«Seine Bedeutung und die Auswirkungen von Stress auf kalte Füsse sind bislang kaum beschrieben», sagt die Fachärztin mit Blick auf den Vagusnerv und plädiert dafür, das Wechselspiel zwischen Sympathikus («Stresssystem») und Parasympathikus («Ruhesystem») genauer anzuschauen. «Wir sind in Daueraktivierung. Zu viele Reize, zu viele Ängste, zu viel Aktivität.» Folge: Der Sympathikus stellt die Gefässe in Händen und Füssen eng. Bedeutet: «Wenig Blut. Wenig Wärme. Kalte Füsse.» Wichtig sei also, den direkten Zusammenhang zwischen kalten Füssen und einem stressigen Lebensstil zu erkennen. Was hilft? Ein sogenanntes Vagustraining, also eine Kombination aus Atem- und Bewegungsübungen und Etablierung einer positiven Grundhaltung, die für mehr Gelassenheit sorgt.
Vermutlich wird man erst mal die hausärztliche Praxis aufsuchen – und je nach vermutetem Grund dann an eine Fachärztin oder einen Facharzt überwiesen. Phlebologin Dr. Schick checkt die Beine ihrer Patientinnen ausführlich. «Dabei achte ich genau auf Farbe, Temperatur und etwaige Veränderungen der Haut. Wie erscheinen die Zehen? Sind sie rosig und gut durchblutet oder sogar bläulich verfärbt? Liegen Verletzungen der Haut vor?»
Anschliessend werde überprüft, wie schnell die Rekapillarisierung erfolge, also wie schnell die Haut wieder rosig werde, wenn durch kurzen Druck aufs Nagelbett eine Stelle weniger stark durchblutet wurde. Geprüft werden dann sogenannte Verschlussindizes mittels Blutdruckmessungen. Mittels Ultraschall begutachtet Dr. Schick auch noch die Beinarterien von oben nach unten, schaut nach Gefässengstellungen und Verschlüssen und beurteilt mögliche Veränderungen der Gefässwand.
Umgehend gehandelt werden muss, wenn der Fuss (oder das Bein) ganz plötzlich kalt wird, stark schmerzt und die Haut blass oder bläulich wird. Auch bei Beschwerden, die nicht akut sind, aber über einen längeren Zeitraum andauern, sollte man ärztlichen Rat suchen.

Gegen kalte Füsse helfen abendliche Fussmassagen mit Rizinusöl (Foto: 123RF/alexanderruiz)
Kälte verstärkt die Gefässengstellung. Darum gilt: Wärme muss her, von innen wie von aussen!
Von aussen wärmen:
- Socken und Schuhe (mit möglichst dicken Sohlen) auf der Heizung bzw. am Ofen vorwärmen.
- Wollstrümpfe tragen, denn in synthetischen Materialien schwitzen die Füsse verstärkt. Folge: Die Nässe auf der Haut kühlt.
- Warme Fussbäder mit Rosmarin, Arnika oder ätherischen Ölen der Nadelhölzer (Latschenkiefer, Fichte, Tanne) nehmen.
- Wärmflasche (mit schützendem Überzug), angewärmtes Kirschkernkissen abends mit ins Bett nehmen und an die Füsse legen.
- Wärmende Einlegesohlen für die Schuhe oder «aufheizende» Wärmepads nutzen.
- Elektrischen Fusswärmer mit «Kuschelsack» anschaffen.
- Abendliche Fussmassage mit angewärmten Rizinusöl; nach der Massage Füsse in vorgewärmte Wollsocken hüllen. Das Öl sorgt über Nacht dafür, dass die Füsse gut durchblutet werden und wohlig warm bleiben.
- gegen kalte Füsse hilft auch Kneippen, um die Durchblutung anzukurbeln
Von innen wärmen:
- Regelmässig heisse Getränke und Suppen sowie (je nach Verträglichkeit) scharfe Gerichte zu sich nehmen.
-
Frischpflanzen-Präparate aus den Blättern des Japanischen Tempelbaumes (Ginkgo biloba) und aus den Früchten des Weissdorns (Crataegus monogyna) unterstützen die Durchblutung.
Die Füsse von Babys sind häufig kälter als der Rest des Körpers, denn die Wärmeregulierung und die Durchblutung funktionieren noch nicht vollkommen stabil. So schliessen sich bei Kälteeinfluss die Hautporen noch nicht vollständig, ausserdem geht über den verhältnismässig grossen Kopf und die spärliche Kopfbehaarung viel Wärme verloren. Trotz kalter Füsschen sollten Babys nicht zu warm angezogen werden. Ist dem Baby tatsächlich zu kalt, zeigt sich das neben sehr kalten Füssen und Händen auch durch kalte Arme und Beine sowie über eine bläulich-schimmernde Haut. Bevor man dem Kind mit Wolldecke und höherer Raumtemperatur «einheizt», sollte man mit der Handfläche im Nacken prüfen, wie warm dem Baby tatsächlich ist. Stellen Sie keine kalte Schweissabsonderung fest, friert das Kind gewiss nicht.
Damit wir einschlafen können, verringert sich die Körpertemperatur bis ca. 3 Uhr nachts um ein Grad. Geht man mit kalten Füssen ins Bett ist das für den Organismus allerdings ein Signal, die Körpertemperatur nicht weiter abzusenken, erklärt Dipl. Psych. Werner Cassel vom Schlafmedizinischen Zentrum der Uni Marburg auf "hr4.de". Zusätzlich wird auch die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin gestoppt. Das hat zur Folge, dass wir nicht einschlafen können. Auch die eigentlich wärmende Bettdecke sorgt nicht gleich dafür, dass sich unsere Füsse aufwärmen. Denn über Kopf, Hände und Füsse gibt der Körper am meisten Wärme ab. Sind diese Körperteile schon kalt, schützt sich der Körper vor weiterer Auskühlung, indem er das Weiten der Blutgefässe in diesen Körperteilen verhindert. Dann hilft nur Wärme von aussen.
ANZEIGE:
Magnesium trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und normalen psychischen Funktion bei.