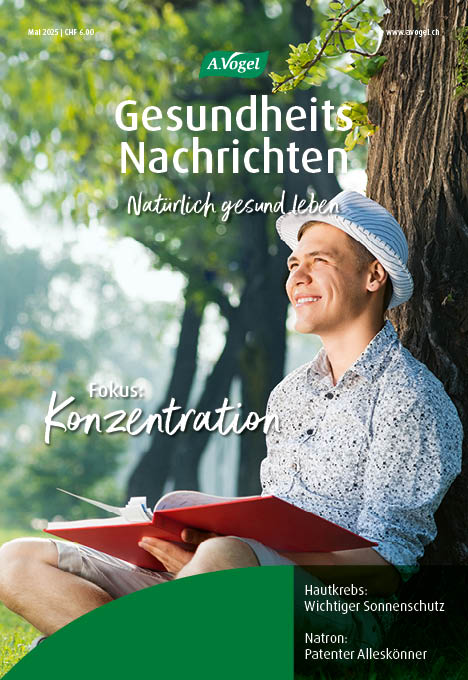A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.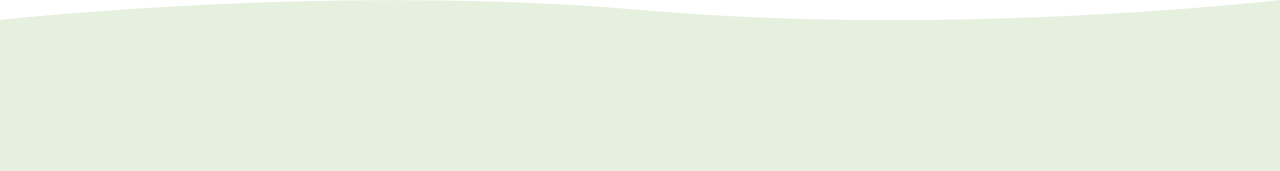
Kinder – im Sog des Computers?
Die Zahl der computersüchtigen Kinder und Jugendlichen wächst. Was können Eltern tun? Eine ganze Menge, finden der Hirnforscher Gerald Hüther und der Zürcher Computersucht-Experte Franz Eidenbenz.
Autorin: Petra Horat Gutmann, 12.12
- Ein kommendes Problem
- Was heisst da «süchtig»?
- Die 3-Kriterien-Regel
- Was geschieht im Gehirn?
- Digitale Überraschungseier
- Mission im Altersheim
- Erzähl' doch mal
- Das Leben ist spannend!
- Süchtig? Besser nicht!
- Erfolgserlebnisse ermöglichen
- Vorbild sein
- Grenzen setzen, Freiraum schaffen
- TIpps: Im Bann des Computers?
Wie ein Wirbelwind fegt der 16-jährige Marc zur Wohnungstür herein und saust durch den Flur in sein Zimmer, wo er sich mit einem Plumps in den Lehnstuhl vor den Computer fallen lässt. Ein Klick und der Bildschirm flimmert, ein paar weitere Klicks und der Junge ist mitten drin in seinem Lieblingsspiel «World of WarCraft» («Welt des Kriegshandwerks»).

Turnschuhe und Jacke sind unterwegs durch die Luft geflogen, den Begrüssungsruf der Mutter aus der Küche hat der Sekundarschüler überhört. Genauso wie den Hinweis, das Abendessen stehe gleich auf dem Tisch. Selbstvergessen surft Marc durch die magische Welt der Gilden, Defias und Wächter – wie fast jeden Abend, im Schnitt während 30 bis 35 Stunden die Woche. Heute dauert der Ausflug ins Internet allerdings etwas weniger lang: Als Marc von einer Pinkelpause in sein Zimmer zurückkehrt, ist der Computer weg. Die Mutter hat ihn beschlagnahmt. Es folgt ein fürchterlicher Streit zwischen Mutter und Sohn, der damit endet, dass Mark stinksauer aus der Wohnung rennt.
Statistischen Erhebungen zufolge sind süchtige Online-Spieler wie Marc in der Schweiz nach wie vor eher selten; ihre Zahl wird bei den Jungs auf maximal drei Prozent geschätzt, bei den Mädchen auf unter ein Prozent. Für Deutschland gelten ähnlich niedrige Zahlen. Doch die Zahl der Computersüchtigen wächst rasch, als «gefährdet» werden weit über 10 Prozent eingestuft, und auch die Fälle von Jugendlichen, die wegen «Gamesucht», also der Sucht nach Computerspielen, oder Internetsucht in psychiatrische Dienste überwiesen werden, nehmen zu.
Fest steht, dass Schweizer Jugendliche vom Online-Gamen «angefressen» sind: Laut einer Umfrage der Pro Juventute von 2008 spielen 95 Prozent der Jungs in ihrer Freizeit Computerspiele, bei den Mädchen sind es fast ebenso viele.
Doch woran erkennt man Computersüchtige? Der deutsche Neurobiologe und Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther liefert eine treffende Beschreibung: «Süchtig, das bedeutet, dass die Kinder oder Jugendlichen selbst bei schönstem Sonnenschein ihr Zimmer nicht verlassen, wie gebannt vor dem Computer hocken, wenig oder widerwillig essen und kaum schlafen, bis tief in die Nächte hinein am Computer spielen und am nächsten Tag übermüdet und desin- teressiert in der Schule sitzen.» In Zahlen übersetzt heisst dies gemäss einer Studie der Humboldt-Universität Berlin: Ab 28 Stunden PC- Gebrauch pro Woche oder vier Stunden pro Tag gilt man als «gefährdet», ab 35 Wochenstunden oder fünf Stunden täglich als «süchtig».
Für den Zürcher Psychotherapeuten Franz Eidenbenz, der seit zwölf Jahren mit Online-Süchtigen arbeitet, ist diese zeitliche Richtlinie allerdings etwas zu einfach gestrickt. «Es kommt nicht primär auf die Dauer der PC-Nutzung an», sagt der Experte für Verhaltenssüchte mit Spezialgebiet neue Medien. «Sinnvoller ist es, den Computerkonsum der Kinder nach drei grundlegend wichtigen Kriterien zu beurteilen:
- Erstens, investieren die Jugendlichen mindestens gleich viel Zeit in computerlose Freizeitaktivitäten ausser Haus, die mit sozialem Kontakt verbunden sind – also zum Beispiel in Sport, Spiel oder Pfadi?
- Zweitens, kommen ihre Hausaufgaben nicht zu kurz, und stimmen die schulischen Leistungen?
- Drittens, erhalten die Jugendlichen genug Schlaf?»
Seien diese Kriterien erfüllt, könne man nicht von einer Computersucht sprechen, sagt Franz Eidenbenz.
Viele Eltern machen sich dennoch Sorgen, ob das tägliche, stundenlange Spielen am Computer den Kindern nicht schadet und ihr Denken nachteilig verändert. Diese Sorge ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn die Strukturierung des menschlichen Gehirns wird dadurch bestimmt, wozu und wie man das Gehirn benutzt.
Dazu erklärt Gerald Hüther, Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung an der Universität Göttingen: «Geschädigt wird das Gehirn von notorischen Online-Gamern nicht, doch es wird umgeformt. Es baut häufig benutzte neuronale Verbindungen zu ‹Autobahnen› aus, während andere Hirnbereiche unterentwickelt bleiben.» Als Folge davon hätten Computerkids also beispielsweise eine starke Auge-Hand-Koordination, während andere Fähigkeiten auf der Strecke blieben, zum Beispiel grob- und feinmotorische Fertigkeiten oder ein differenziertes sprachliches Ausdrucksvermögen.
Den Gebrauch von Computern verteufeln mag der Hirnforscher aber nicht: «Computer sind wunderbare Werkzeuge, mit denen man sinnvoll planen, organisieren, kreativ gestalten und auf weite Entfernungen kommunizieren kann.»
Das Problem liege woanders: «Computer werden von Kindern und Erwachsenen auch zur Affektregulation benutzt. Das heisst: Als Krücken, um Affekte wie Wut, Langeweile oder Sehnsucht zu kom- pensieren.» Mit der Zeit bekämen die Nutzer dann ein Gehirn, das die selbstständige Fähigkeit zur Affektregulation verloren habe.
Für Gerald Hüther geht die Computersucht einher mit einer aussenorientierten Lebensweise, genau wie auch die Fernsehsucht: Der Konsum und Genuss von äusseren Stimuli wird wichtiger als die persönliche Anstrengung und kreative Eigenleistung. Dabei sind die Rezepte, die uns wirklich glücklich machen, tief in unseren Gehirnen verankert. Gerald Hüther nennt das Beispiel eines kleinen Kindes, das sich mit Mühe und Not an einem Stuhlbein hochgezogen hat und nun zum ersten Mal in seinem Leben selbstständig steht: «Sein Gesicht strahlt vor Freude, es hat ein wunderbares Kohärenzgefühl.»
Dieses Glück unterscheide sich grundlegend vom Glücksgefühl eines Jungen, der soeben seine Mutter im Supermarkt überredet habe, ihm ein Überraschungsei zu kaufen. Viele «Games» am Computer seien blosse Überraschungseier.
Es geht auch anders, wie erfinderische Erwachsene zeigen. Etwa jener Vater, der für seinen 15-jährigen, computerverrückten Sohn und dessen Freunde eine Software-Firma gegründet hat und die Jungen ins Altersheim schickt. Dort zeigen die Computerkids den Senioren, wie man via Facebook und E-Mail mit den Angehörigen in Kontakt bleibt. Mittlerweile gefällt das den Buben viel besser als die endlosen Ballerspiele am PC. Gerald Hüther: «Diese Jungs haben gemerkt, dass sie etwas zustande bringen, was anderen Freude bereitet und ihnen hilft. Obendrein verdienen sie sogar noch ein wenig Geld damit.»
Das Beispiel erinnert an andere Projekte aus der Kinderpädagogik; daran, dass chronische «Fernsehkinder» das Interesse an der Flimmerkiste verlieren, sobald ihnen Aufgaben anvertraut werden, die ihre Sehnsucht nach Selbständigkeit, Kompetenz und Verbundenheit im realen Leben befriedigen: zum Beispiel die Pflege eines Kleintierzoos zusammen mit anderen Kindern. Es erinnert auch an Projekte mit Jugendlichen, die nicht mehr vor der Glotze sitzen mögen, weil man ihnen die Gelegenheit bietet, selbst im Team einen Film zu drehen. «Solche Erfahrungen können Kinder vor allem im gemeinsamen Tun machen», weiss Gerald Hüther, «wenn sie zusammen mit anderen wichtige Aufgaben erfüllen oder sich um andere Menschen kümmern.»
Zum Finden sinnvoller Beschäftigungen gehört, dass Eltern und Kinder miteinander reden. Es dürfte kein Zufall sein, dass sich Eltern von computersüchtigen Kindern in der Regel kaum dafür interessieren, was die Jungen eigentlich genau machen, hat Psychotherapeut Franz Eidenbenz in seiner Praxis beobachtet.
Dabei sei es wichtig, unterstreicht der Spezialist, dass sich Eltern für den Inhalt der kindlichen Computerspiele interessieren und sich beispielsweise fragen: Welche Figur, welchen «Avatar» spielt mein Sohn in der virtuellen Welt? Welche Inhalte hat das Spiel, das meine Tochter so fasziniert? Solche Gespräche könnten das Verständnis für die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Kinder vertiefen. Nicht selten käme dabei auch Überraschendes zum Vorschein: Etwa dass ein Kind in die virtuelle Welt abtauche, weil es dort Freunde nde, die ihm in der Schule fehlten, oder weil im Internet niemand da sei, der dauernd herumnörgele.
Laut Gerald Hüther hat jedes «computersüchtige Gehirn» seine eigene Geschichte. Dennoch zeige die Erfahrung, dass sich die meisten ehemaligen Computersüchtigen auf ähnliche Weise von ihrer Sucht befreit hätten: «Irgendwann ist etwas passiert, was ihr Vertrauen, ihren Mut, ihre Lust am realen Leben, am Entdecken und Gestalten nachhaltig gestärkt hat.»
Die Initialzündung sei meist durch eine Begegnung mit anderen Menschen, eine neue Herausforderung oder eine selbstständig erbrachte Leistung entstanden. So erging es auch Marc. Kurz nach der elterlichen Beschlagnahmung seines Computers begann er eine Lehre als Schreiner. Die praktische Tätigkeit, die neuen Kollegen und das Lob des Lehrmeisters beflügeln ihn so, dass er von alleine immer seltener vor dem Computer sitzt.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Wie kann man verhindern, dass Kinder und Jugendliche computersüchtig werden? Hier sind einige Denkanstösse des Hirnforschers Gerald Hüther und des Psychotherapeuten Franz Eidenbenz.
«Moderne Eltern neigen dazu, ihre Kinder zu verwöhnen. Sie schleppen sie von Glücksmoment zu Glücksmoment, die Kinder wachsen auf wie in Watte verpackt», beobachtet Gerald Hüther. «Dabei ist es für Kinder in erster Linie wichtig, dass sie Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, die ihnen Mut und Selbstvertrauen geben und ihnen helfen, an ihre Ziele zu kommen.» Mit anderen Worten: Kinder und Jugendliche brauchen Gelegenheiten zum Gestalten und Entdecken der Welt, sie sollen Abenteuer bestehen und möglichst unterschiedliche Situationen erleben dürfen.
«Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren und denen sie nacheifern können, weil sie etwas ausstrahlen, das sie selber noch nicht entwickelt haben», unterstreicht Gerald Hüther. Dazu gehöre, dass Eltern in ihren Kindern die Überzeugung nähren, dass man Probleme fortlaufend lösen und daran wachsen kann. Dass es sich lohne, sich anzustrengen und möglichst viele Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.
In der Tat ist die Fähigkeit, sich im Leben zurechtzufinden und sich nicht von Misserfolgen entmutigen zu lassen, nicht angeboren oder zufällig. Gerald Hüther: «Sie wird durch Lernprozesse herausgeformt, die auf Erfahrung beruhen. Mit jedem gelösten Problem wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und mit ihm der Mut, vor neuen, grösseren Problemen nicht zu kapitulieren.»
Die moderne Kleinfamilie bietet Kindern in mancher Hinsicht weniger Freiräume als die frühere Grossfamilie. Das Problem dabei: «Wenn der Freiraum, Sachen auszuprobieren schwindet, weil alles kontrolliert ist, suchen Jugendliche eher die Freiheit virtueller Räume», sagt Franz Eidenbenz.
Trotzdem findet es der Suchtexperte wichtig, klare Regeln für den Computerkonsum festzulegen und diese mit Hilfe sinnvoller Anerkennungen und Bestrafungen durchzusetzen. Ein Beispiel: «Wenn es ein Jugendlicher schafft, seinen Computer unter der Woche selbstständig immer zur vereinbarten Zeit auszuschalten, kann man ihn mit einem freien Abend ausser Haus belohnen oder mit ihm etwas unternehmen, das er sich wünscht. Schafft er es nicht, kann man ihm beispielsweise weniger an die Handyrechnung zahlen.»
Wichtig sei, dass die gewählten Anerkennungen und Bestrafungen «konstruktiv» seien. So sei es beispielsweise keine gute Idee, einem Kind den Sportclub zu verbieten, weil es am Vorabend zu lange am Computer gespielt habe. Genauso kontraproduktiv seien Regeln, denen es an Verständnis für die Jungen fehle: «Wenn der Jugendliche in einem Online-Spiel zusammen mit einer Gilde eine gemeinsame Aufgabe löst, die zwei Stunden dauert, ist es keine gute Idee, den Computer nach einer Stunde abzuschalten.»
Anzeichen von Abhängigkeit oder Sucht bei «computerverrückten» Kindern und Jugendlichen können sein:
- Ein unwiderstehlicher Zwang zum Einloggen
- Entzugserscheinungen in Form von Unruhe,
- Nervosität oder Reizbarkeit bei Verhinderung am Chatten oder Gamen
- Mehrmalige vergebliche Versuche der Einschränkung
- Nachlassende Schul- und Arbeitsleistung
- Vernachlässigung von grundlegenden Aktivitäten wie Essen und Schlafen
- Vernachlässigung von früher geschätzten Hobbies und von Freundschaften
- Die soziale Umwelt wird zunehmend als Last empfunden, jede Aufgabe für Schule, Ausbildung oder Familie als Zumutung.