A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.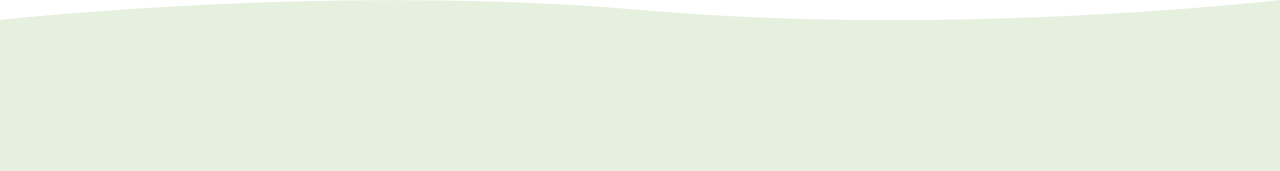
Schmerzen – wenn sie einfach nicht weggehen
Chronische Schmerzen
Chronische Schmerzen gehören zu den grossen Gesundheitsproblemen. Die Ausgaben für Diagnostik und Therapie sind hoch, ebenso die volkswirtschaftlichen Kosten wegen Arbeitseinschränkungen/-unfähigkeit und Renten.
In Deutschland wird die Zahl der Erwachsenen mit chronischen Schmerzen auf 12 Millionen geschätzt (Pain Proposal 2010). In der Schweiz geht man von 1,2 Millionen chronisch Schmerzkranken aus. In Österreich rechnet man mit 1,5 Millionen. Am höchsten ist der Anteil in Norwegen, Polen und Italien. Über ein Viertel der Erwachsenen in diesen Ländern gibt an, unter chronischen Schmerzen zu leiden. Die wenigsten Schmerzkranken leben in Spanien, obwohl auch hier 11 Prozent der Bevölkerung von chronischem Schmerz betroffen sind. (Pain in Europe Survey, 2002/2003)
Autorin: Ingrid Zehnder
- Schmerz – die eigenständige Krankheit
- Die gute Nachricht
- Der Glaube versetzt Berge
- Chronische Schmerzen und die Folgen
- Tango statt Fango
- Gene spielen mit
- Gene Risikofaktoren für Migräne
- Fast jeder hat mal «Rücken»
- Nervenschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Die multimodale Schmerztherapie
- Viel muss sich noch ändern
- Körperliche und psychosoziale Schmerzen klarer trennen
Akute Schmerzen entwickeln sich dann zu chronischen Schmerzen, wenn sie nicht ausreichend gelindert werden (können). Wird das Nervensystem ständig mit Schmerzsignalen bombardiert, verändert es sich nachhaltig. Stete Schmerzreize, die zum Rückenmark gelangen, können die Verarbeitung der Sinnesinformationen umgestalten. Bisher inaktive Nozizeptoren werden erregt, unerwünschte Lernprozesse der Nervenzellen etablieren sich im Rückenmark und im Gehirn, auf molekularbiologischer Ebene kommt es zu erheblichen Veränderungen, neue Proteine werden hergestellt.
Es bildet sich eine Gedächtnisspur, die sich als Schmerzgedächtnis im Rückenmark ausbildet: der Schmerz überdauert die eigentliche Ursache etwa eine Verletzung, eine Entzündung oder eine Operation um Wochen, Monate oder Jahre. Der ursprüngliche Auslöser fehlt, der Schmerz bleibt. Die Entstehung und der Verlauf der Krankheit chronischer Schmerz hängt, wie man inzwischen weiss, jedoch nicht ausschliesslich von körperlichen, sondern auch von seelischen und sozialen Faktoren ab. Denn das Gehirn kann die durch die Nerven vermittelten Schmerzimpulse mit den persönlichen Gefühlen und Erfahrungen verknüpfen. Dementsprechend ist das Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln, höher, wenn die Betroffenen mit Depression, Angst und Hilflosigkeit auf Schmerzen reagieren.

Die Spirale aus Schmerzerfahrung, Anspannung und Angst vor neuen Schmerzen kann durchbrochen werden. Die Schmerzspuren im Gehirn sind nicht auf ewig festgeschrieben. Die Lernfähigkeit und enorme Plastizität des menschlichen Gehirns macht es möglich, neue Erfahrungen im Gehirn zu verankern, wodurch alte Erinnerungen allmählich verblassen.
Mit der richtigen Therapie kann das Schmerzgedächtnis wieder gelöscht bzw. überschrieben werden. Eine Möglichkeit dazu ist die psychologische/psychotherapeutische Behandlung. Einen neuen vielversprechender Ansatz veröffentlichten Schmerzforscher der Medizinischen Universität Wien und der Universitätsmedizin Mannheim im Januar 2012 im Wissenschaftsmagazin Science: Im Laborversuch gelang es, mit einer sehr kurzen, hoch dosierten Anwendung von Opioiden das Schmerzgedächtnis löschen.
Wie tiefgreifend der Einfluss psychologischer Faktoren auf die Schmerzwahrnehmung sein kann, fanden Neurowissenschaftler und Schmerzforscher aus Hamburg und Zürich heraus. Mit Hilfe hochmoderner Verfahren konnten sie nachweisen, dass allein schon die Erwartung, der Schmerz werde sich verringern, diesen tatsächlich abschwächt, auch wenn der schmerzhafte Reiz sich gar nicht geändert hatte. Sie konnten nicht nur zeigen, dass sich Schmerzantworten des Rückenmarks sich durch den Placebo-Effekt mindern lassen, sondern ihn auch im Gehirn lokalisieren.
Der immer wiederkehrende oder gar tägliche Schmerz quält und lähmt. Er raubt den Betroffenen die Freiheit und zerstört die Lebensfreude. Nicht nur, dass sie ständig Leid ertragen müssen sie machen auch häufig die Erfahrung, dass ihre Krankheit nicht ernst genommen wird. Arbeitgeber, Kollegen, Versicherer und Ämter zeigen oft wenig Verständnis für eine Krankheit, die man nicht sieht und deren Ursachen keiner kennt. Viele Schmerzkranke erleben, dass ihr Gesundheitszustand negative Auswirkungen auf das Zusammenleben mit Familie und Freunden hat. Ein Viertel der Kranken beklagt, dass sie bei der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten oder bei der Therapie allein gelassen werden. Die Folge ist, dass sie sich ausgegrenzt fühlen und sich selbst isolieren. Etwa 15 Prozent der Schmerzkranken gehen kaum noch aus dem Haus. Ungefähr ein Drittel leidet unter Depressionen. Jeder Zehnte hat schon einmal daran gedacht, einfach endgültig Schluss zu machen und somit sein Leiden zu beenden.
Der bekannte deutsche Schmerzforscher Prof. Walter Zieglgänsberger sagte schon vor Jahren in einem Interview mit der ZEIT: «Was Menschen gelernt haben, können sie auch wieder verlernen. Erst einmal müssen wir den Schmerz abschalten. Dazu brauchen sie meistens ein Medikament. Doch das ist nur eine Krücke. Da haben wir in der Vergangenheit Riesenfehler gemacht. Sobald wir die Patienten schmerzfrei hatten, liessen wir sie häufig allein. Aber wenn wir die Programmierung ihres Nervensystems auf den Schmerz nicht rückgängig machen, kommen die Qualen wieder.»
Daher plädierte er auch schon früh für psychotherapeutische Massnahmen, die helfen, die Angst vor dem chronischen Schmerz zu überwinden. Dr. Zieglgänsberger fügte hinzu: «In dem Mass, in dem die Patienten ihre Lebensfreude wiederentdecken, verlieren sie ihre Angst und hören auf, sich wieder und wieder mit ihrem Leid zu beschäftigen. Zu viel Schonung bringt gar nichts. Eine gute Schmerztherapie lässt sich auf eine flapsige Formel bringen: Tango statt Fango.»
Bei der Wahrnehmung von Qualen wirken, wie gesagt, viele Faktoren zusammen von früheren Schmerzerfahrungen bis zur sozialen Situation oder der persönlichen Einstellung gegenüber dem Leid. Sowohl bei der Schmerzempfindlichkeit als auch bei der Wirksamkeit von Schmerzmitteln zeigen sich grosse individuelle Unterschiede.
Bausteine zum Verständnis dieser Tatsachen liefert die Genforschung, die mit der Möglichkeit, genetische und bildgebende Verfahren zu kombinieren, neue Einblicke in die Schmerzwahrnehmung erlaubt. Auf dem Internationalen Wiener Schmerzsymposium 2012 sagten Forscher, es gebe zwar gibt es kein spezielles Schmerz-Gen, jedoch 400 bis 500 Gene, die mit der Schmerzwahrnehmung zusammenhängen. Sie beeinflussen die Produktion schmerzverstärkender oder schmerzhemmender Botenstoffe sowie die Aufnahme von Wirkstoffen und ihre Verarbeitung im Stoffwechsel individuell mehr oder weniger stark. Von diesen Forschungen verspricht man sich in Zukunft die Entwicklung massgeschneiderter Therapien und Medikamente.
Im Juli 2012 erschien die Meldung, ein grosses internationales Forscherteam habe vier spezifische Gene identifiziert, die nur im Erbgut von Menschen vorkommen, die unter Migräne ohne Sehstörungen (ohne Aura) leiden.
Neben diesen bislang unbekannten genetischen Auslösern fanden die Wissenschaftler auch zwei bereits bekannte Veränderungen im Erbgut. Diese waren zusammen mit zwei weiteren schon zuvor bei Menschen mit der selteneren Migräne mit Aura entdeckt worden. Die Veränderungen betreffen Blutfluss, Erregbarkeit des Gehirns und Anhäufungen des Neurotransmitters Glutamat an den Kreuzungen von Nervenbahnen (Synapsen).
Die Medizin erhofft sich von diesen Ergebnissen mögliche Ansatzpunkte für die Entwicklung von Medikamenten. Für die Betroffenen ist es auch wichtig, sicher zu wissen, dass Migräne biologische und nicht, wie oft vermutet, psychosomatische Ursachen hat.

Die häufigste Ursache chronischer Schmerzen liegt in Erkrankungen des Bewegungsapparates, und hier nehmen Rückenprobleme und Bandscheibenvorfälle die Spitzenpositionen ein.
Oft kann weder mit Bildverfahren noch durch Untersuchungen eine eindeutige Ursache für die Beschwerden festgestellt werden. Neueren Forschungen zufolge gelten etwa 85 Prozent aller Rückenschmerzen als unspezifisch, das heisst, ihre Ursache bleibt unklar.
Manche Personen, bei denen ein Bandscheibenvorfall festgestellt wurde, sind weitgehend schmerzfrei. Bei anderen, die über starke Rückenschmerzen klagen, können keine oder nur geringfügige Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule festgestellt werden.
Und doch wird so häufig operiert wie nie zuvor. Die Zahl der operierten Bandscheibenvorfälle hat sich in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, die der Versteifungeingriffe sogar verdreifacht.
Dabei wissen viele Experten: Bandscheibenvorfälle, die keine Lähmung zur Folge haben, brauchen zu 90 Prozent keine Operation. Und: Die operativen Eingriffe können den gewünschten Erfolg keineswegs garantieren.
«Schuld» sind nicht nur die Kliniken, die an den Operationen interessiert sind, sondern auch die Patienten, denen der schnelle chirurgische Eingriff lieber ist, als selbst vorbeugend mit gezieltem, doch anstrengendem und zeitraubendem Training etwas für eine dauerhafte Besserung zu tun.
Konsequent durchgeführte Behandlungen mit Medikamenten, Physiotherapie, manueller Therapie, Akupunktur, Biofeedback und eventuell Gesprächen mit Psychologen, die sich mit Schmerzbewältigung auskennen, können vielen Rückenkranken helfen.
Chronische, sehr starke Nervenschmerzen, wie sie bei Phantomschmerzen, Trigeminusneuralgien, als Folge von Diabetes, Gürtelrose oder Krebs auftreten können, sind nicht leicht in den Griff zu bekommen. Klassische Schmerzmittel wie z.B. Aspirin oder nicht-steroidale Antirheumatika helfen kaum. In vielen Fällen profitieren die Kranken eher von einer Behandlung mit Wirkstoffen, die ursprünglich gegen Depression oder Epilepsie entwickelt wurden, da diese an den Nervenzellen wirken.
Bei den Gelenkbeschwerden, die mit zu den häufigsten chronischen Schmerzen zählen, unterscheidet man grob zwischen durch Abnutzung entstandenen Schäden wie Arthrose und solchen, die durch Entzündungen ausgelöst werden wie rheumatoide Arthritis. Diese, oft unter dem Begriff Gelenkrheuma zusammengefassten Beschwerden sprechen in einem frühen bis mittleren Stadium gut auf die meist besonders verträglichen und wirksamen Phytotherapeutika an. «Die Behandlung von rheumatischen Beschwerden mit pflanzlichen Präparaten ist sinnvoll und verspricht Erfolg», bestätigt auch Dr. med. Reinhard Saller, Professor für Komplementärmedizin an der Universität Zürich.
Sie gilt als die modernste, wissenschaftlich fundierte Therapieform zur ganzheitlichen Behandlung chronischer Schmerzen. Ein interdisziplinäres Team aus speziell ausgebildeten Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern und Therapeuten plant nach ausführlichen Gesprächen mit dem Kranken gemeinsam die gleichzeitige, aufeinander abgestimmte Behandlung mit verschiedenen körperlichen und psychologischen Therapieformen. Dazu gehören Programme zur körperlichen Aktivierung, Physiotherapie, Biofeedback, elektrische Nervenstimulation TENS, Stosswellentherapie, psychologische Beratung, Verhaltenstherapie, Entspannungsübungen, eventuell ergänzt durch Partner-, Musik- und Tanztherapie.
Unabdingbar ist dabei die aktive Mitarbeit der Teilnehmenden, denn nur so können sie die Beschwerden dauerhaft in den Griff bekommen. Die zwischen drei und sechs Wochen dauernden Angebote sind wegen ihrer hohen Behandlungsintensität kostspielig. Die Krankenkassen haben jedoch kalkuliert, dass die Ausgaben sich in den Folgejahren rechnen, denn bei bis zu 85 Prozent der Rückenkranken sind die Programme erfolgreich.
Allerdings ist diese Art der Therapie noch Mangelware. Sie wird hauptsächlich an Universitäten wie Zürich, Freiburg (D), Mannheim, München, Köln, Erlangen, Göttingen, Dresden u.a. oder regionalen Schmerzzentren wie Göppingen und einigen Fach- und Privatkliniken praktiziert.
In der Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen bestehen noch viele Defizite. In der Schweiz bzw. in Deutschland vergehen durchschnittlich 2 Jahre (Europa 2,2 Jahre) von der ersten medizinischen Konsultation bis zur Diagnose und weitere 1,7 bzw. 2 Jahre (Europa: 1,9) bis zu einer angemessenen Behandlung.
Die Situation ist nicht nur geprägt von langen Wartezeiten, sondern auch von mangelnder Ausbildung und Unsicherheit vieler (Haus-) Ärzte, von denen sich nur die Hälfte ausreichend kompetent fühlt. In der Schweiz geben 42 Prozent der Schmerzkranken an, ihr Leiden werde nicht angemessen behandelt (Europa: 38 Prozent). Das von namhaften Experten aus 15 europäischen Ländern betreute Projekt «Pain Proposal» von 2010 (aus dem die obigen Daten stammen) zeigt, «dass die ineffiziente Behandlung von chronischen Schmerzen zu einer längeren Leidenszeit der Patienten und zu steigenden Gesundheitskosten führt», wie Prof. Dr. Eli Alon, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes, sagt.
An der ETH Zürich hat man eine Methode gefunden, die Ärztinnen und Ärzten helfen soll, körperlichen und psychosozialen Schmerz von Betroffenen besser zu unterscheiden. Denn Schmerz ist nicht gleich Schmerz, er erfordert je nach Ursache andere Therapien. Ist der Schmerz vor allem körperlich bedingt, dürften sich Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung vor allem auf die körperliche Ebene konzentrieren, u.a. mit Medikamenten oder Physiotherapie. Spielen psychosoziale Faktoren bei der Schmerzerfahrung eine entsprechende Rolle, könnte es angezeigt sein, die Wahrnehmung von Schmerz mit psychologischer oder psychotherapeutischer Unterstützung positiv zu verändern.


