A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.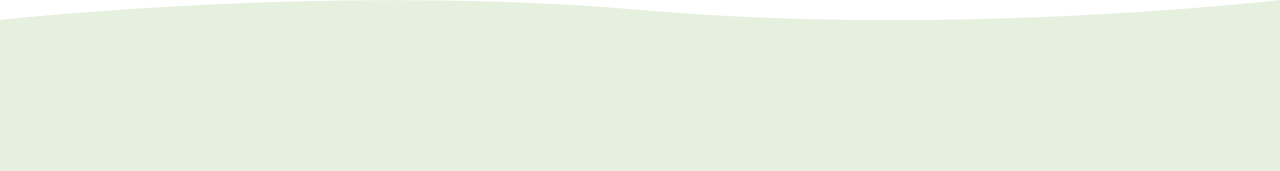
Heilkraft der Musik
Von der (Heil-)Kraft der Klänge
Die Melodien von Vivaldi, Mozart, Bach und anderen Komponisten wirken wie eine Art Schmiermittel und Fitnesstraining für die grauen Zellen im Gehirn.
Kinderlieder wie «Hoppe, hoppe, Reiter» oder «Guter Mond, Du gehst so stille» singen viele Eltern ganz spontan ihren Babys vor. Dass Musik eine beruhigende Wirkung auf Kleinkinder hat, wissen Mütter seit Generationen. «Meine 10-jährige Tochter wünscht heute noch ab und zu, dass ich ihr abends ein Schlaflied singe», erzählt Marianne W. Schmunzelnd fügt die allein erziehende Ostschweizerin an: «Oft fallen ihr die Augen zu, noch während ich singe.» Bei manchen Säuglingen erzielt eine Spieldose eine ähnliche Wirkung.
Autor: Adrian Zeller
Das Denk- und Fühlorgan beim aktiven Musizieren zu beobachten, ist ganz besonders interessant. «Ein Instrument zu spielen ist eine der komplexesten menschlichen Tätigkeiten», schreibt Professor Hans Günther Bastian vom Institut für Musikpädagogik an der Universität Frankfurt a. M.
Beim Vom-Blatt-Spielen müsste eine extreme Fülle und Dichte von Informationen gleichzeitig verarbeitet werden. Zum Musizieren brauche es ratio, emotio und motio, also Verstand, Gefühl und Motorik.
Bastian ist ein vehementer Verfechter einer intensiven Musikpädagogik bei Kindern, und dies aus gutem Grund: Der Wissenschafter leitete eine Langzeitstudie an sieben Berliner Schulklassen. Dabei wurden Schülerinnen und Schüler, die eine so genannte erweiterte Musikerziehung genossen, mit Kindern verglichen, die am regulären schulischen Musikunterricht teilnahmen. Die erweiterte Musikerziehung bestand aus Musikunterricht, dem Erlernen eines Instruments sowie dem Spielen im Ensemble. Während sechs Jahren wurde eine Reihe von Faktoren wie das Sozialverhalten gemessen.
Laut der Studie hat sich dieses durch das aktive Musizieren markant verbessert. Ablehnende oder ausgrenzende Haltungen anderen Schülern gegenüber nahmen in den Musik-Klassen deutlich ab. Musik sei ein Kontaktmedium par excellence, betont Bastian.
Im Weiteren stieg bei den Musik-Schülerinnen und -Schülern der Intelligenzquotient messbar an. Auch die Konzentrationsfähigkeit war höher als bei den Vergleichsklassen. Die Kinder empfanden sich auch als weniger ängstlich.
Wenn viel Zeit für die erweiterte Musikerziehung aufgewendet wird, drängt sich die Frage auf, ob denn nicht die anderen Fächer quasi zu Stiefkindern werden?
«Der erhebliche Zeitaufwand geht ganz eindeutig nicht zu Lasten der allgemeinen schulischen Leistungen», hält Hans Günther Bastian fest. Der prozentuale Anteil der Kinder mit überdurchschnittlich guten Leistungen sei in den musizierenden Klassen vergleichsweise höher. Aufgrund seiner Studien kommt er zum Schluss, dass aktives Musikmachen eine wirkungsvolle Prophylaxe gegen die zunehmende Jugendgewalt ist.

Musik hält geistig fit: Senioren, die Instrumente spielen oder singen, haben offenbar ein leistungsfähigeres Gehirn. Das legen Studien nahe. Eine Forschungsgruppe unter Leitung von Wissenschaftlern der Universität Exeter nutzte Daten der britischen «Protect»-Studie. Diese soll ergründen, wie Gehirne altern und warum Menschen an Demenz erkranken. Die ausgewählten Studienteilnehmer, deren Durchschnittsalter 68 Jahre betrug, wurden nach ihren musikalischen Erfahrungen sowie ihrem lebenslangen Umgang mit Musik befragt. Tests zeigten, dass das Spielen eines Instruments, besonders eines Klaviers oder Keyboards, mit einer Verbesserung des Gedächtnisses und der Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen, verbunden war. Auch das Musizieren mit Holz- oder Blechblasinstrumenten wirkte sich positiv aus. Wurde das Musizieren bis ins Alter fortgeführt, war der Nutzen noch grösser.
Die beeindruckenden Studienresultate haben auch Kritiker auf den Plan gerufen und unter Fachleuten zu Kontroversen geführt. Mittlerweile hat sich die Euphorie, die die Studie ausgelöst hat, etwas gelegt: Musizieren ist natürlich kein Allheilmittel gegen sämtliche schulischen und gesellschaftlichen Probleme.
Dass Musik im Gehirn Erstaunliches auszulösen vermag, ist aber unbestritten. Auch ohne aufwändiges Forschen können Fachleute Gehirne von Musikern und Nicht-Musikern bereits in ihrem strukturellen Aufbau unterscheiden. Bei Anfängern führt bereits 20-minütiges Üben eines Instruments zu nachweisbaren Veränderungen im Gehirn.
Was ist die Ursache, dass die Melodien von Vivaldi, Bach und Mozart auf die Gehirnwindungen so eine erstaunliche Wirkung haben? Neuropsychologe Lutz Jäncke, Professor an der Universität Zürich, spricht von so genannten Transfereffekten. «Musik hat die Möglichkeit, viele psychische Funktionen im Gehirn anzustossen, und dies auf eine Weise, die den Kindern keine besonders grosse Mühe bereitet.»
Beim Erlernen eines Instruments trainiert das Kind ganz allgemein, wie man neue Fertigkeiten erwirbt, es braucht Ausdauer, Konzentration und Selbstdisziplin. All dies sei generell für die Lebensbewältigung wichtig, so Jäncke.
Mit anderen Worten: Konzentration und Selbstdisziplin beim Spielen eines Instruments zu trainieren, fällt deutlich leichter als beim mühseligen Pauken von Vokabeln. Fachleute vermuten, die Wirkung von Musik sei mit dem Grundtraining eines Sportlers vergleichbar: Das regelmässige Üben von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit schafft die Basis für anspruchsvolle Leistungen in einer Einzeldisziplin wie Kugelstossen oder Rudern. Beleg für die Annahme der fördernden Wirkung sind Testergebnisse der Universität Hongkong, die zeigen, dass Musikerinnen und Musiker ein besseres Gedächtnis haben als jene Menschen, die kein Instrument spielen.
Früher ging man davon aus, dass die verschiedenen geistigen Fähigkeiten in bestimmten umgrenzten Zonen im Gehirn angelegt sind. Wie sich mittlerweile zeigte, ist diese Vorstellung ungenau: Diverse Funktionsareale sind untereinander verbunden und stimulieren sich gegenseitig, so auch die Zentren für Musik und für Sprache.
Babys können, lange bevor sie den Sinn einzelner Wörter verstehen, die Melodien unterschiedlicher Sätze auseinander halten. In der 28. Schwangerschaftswoche ist das Gehör voll entwickelt, ab diesem Stadium ist der Embryo körperlich in der Lage, die Stimme der Mutter aufzunehmen. Wenn sie häufig singt, bedeutet dies für das kindliche Gehirn sowohl vor als auch nach der Geburt eine optimale Förderung. Es regt die sprachliche wie auch die musikalische Entwicklung an; Tonhöhe, Lautstärke, Klangfarbe sowie Zeitintervalle spielen sowohl in der Musik wie auch in der gesprochenen Sprache eine wichtige Rolle. Harmonien, Schwingungen und Resonanzen haben überdies eine beruhigende Wirkung auf das Kind.
Apropos Musik und Sprache: Bei manchen überlieferten Briefen Mozarts weiss man nicht so recht, ob sie eher als sprachlich chaotisch oder als virtuos zu bezeichnen sind. Mit Sicherheit stammen sie aus einem aussergewöhnlichen Gehirn und sind ein guter Beleg dafür, wie eng die Zentren für Musik und für Sprache gekoppelt sein müssen. Beispiele: «Jemand in seiner sänfte sanft tragen – ich bin von Natura aus sehr sanft, und einen senf esse ich auch gern, besonders zu dem Rindfleisch», «dero gehorsamster unterthänigster diener, mein arsch ist kein Wiener.»
Hirnforscher sprechen von «Zeitfenstern», Lebensphasen, die zum Erlernen bestimmter Fertigkeiten besonders geeignet sind. Beim Instrumentalunterricht scheint es besonders wichtig zu sein, dass er vor dem achten Lebensjahr einsetzt. Es ist jedoch nie zu spät, ein Instrument zu lernen. Auch im Erwachsenenalter hat das Musikmachen noch immer einen messbar günstigen Effekt auf die rund 100 Milliarden Gehirnzellen und deren Verbindungen untereinander. Neue Untersuchungen deuten überdies darauf hin, dass Musizieren eine hemmende Wirkung auf Demenz-Erkrankungen hat.
Fazit: Musik ist nicht nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib, sondern ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität. «Ohne Musik» schrieb Friedrich Nietzsche, «ist das Leben ein Irrtum.»



