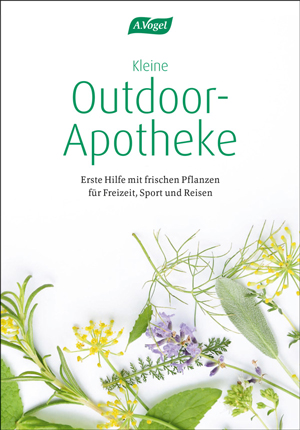A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.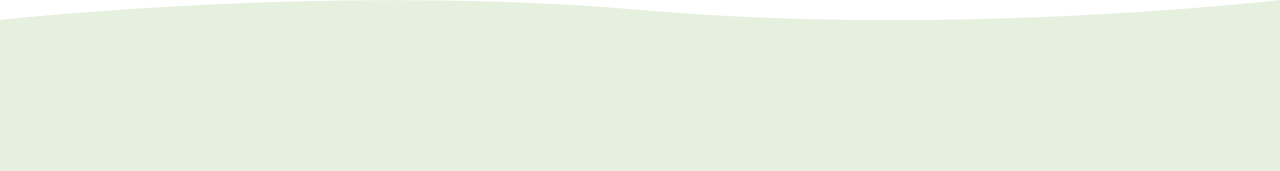
Worte, die helfen und heilen
Agressive Kinder: Wie die Sprache, so das Denken?
Ihr Kind ist aggressiv, frech oder zerstreut? Es hört gar nicht hin, auch wenn Sie sich den Mund fusselig reden? «Wenn Mutter und Vater auf ihre Alltagssprache achten, verbessern sich solche Situationen meist von alleine», weiss die Pädagogin und Begründerin des Lingva-Eterna®-Sprachtrainings Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf.
«Mein Sohn Kevin soll im Herbst in die Schule, doch da gibt es ein Problem: Kevin ist aufbrausend, aggressiv und fast täglich im Streit mit anderen Kindern. Ausserdem ist er sehr chaotisch. Sein Zimmer schaut ständig aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Immer muss ich kämpfen – ich lebe im Dauerstress. Bitte helfen Sie mir!»
Autorin: Petra Gutmann
Mit diesen Worten wandte sich Kevins Mutter Sonja an die Pädagogin und Sprachtrainerin von Scheurl-Defersdorf. Die 55-Jährige tat zunächst nur eins: Sie hörte aufmerksam zu und notierte Sonjas Worte akribisch.
Aus folgendem Grund, wie sie erklärt: «Die gewohnte Ausdruckweise der Erwachsenen stammt aus der Kindheit und Jugendzeit, angereichert um ein paar Fremdwörter und Fachbegriffe. Ich erlebe immer wieder, dass sich der kommunikative Draht zum Kind verbessert und sich Probleme in Luft auflösen, wenn Erwachsene beginnen, auf ihre Sprache zu achten und die in ihr liegende Kraft erkennen. Das ist die Essenz des Sprachtrainings von Lingva-Eterna®.»
Nach dem ersten Gespräch mit Sonja W. war für Mechthild von Scheurl-Defersdorf klar: «Sonjas Sprache ist voll von Wörtern aus dem Wortfeld des Kampfes und des Streites, zum Beispiel ‹kämpfen, streiten, schimpfen, Konflikt, Bombe, aggressiv, den Spiess umdrehen› und so weiter.»
Das hatte Folgen: «Wann immer ein Mensch ein bestimmtes Wort gebraucht, aktiviert er gleichzeitig die in ihm gespeicherten Emotionen», erklärt die zweifache Mutter. «Wenn jemand ein Wort gewohnheitsmässig denkt oder sagt, so hat das tiefgreifende Auswirkungen auf sein Leben.»
So war das auch bei Sonja. Mit ihren Kampf- und Stress-Wörtern säte sie an-dauernd Konflikte. Es erstaunte deshalb nicht, dass Sohn Kevin mit der Muttersprache auch deren aggressives Handlungspotential erworben hatte und gewohnheitsmässig Kampf- und Streitwörter benutzte, zum Beispiel «schlagen», «draufhauen», «k.o. machen» oder «ich krieg’ die Krise»

Dabei liebt Sonja ihren Sohn über alles. Nicht im Traum hatte sie daran gedacht, dass ihre Alltagssprache solche Auswirkungen hatte. «Den meisten Erwachsenen ist nicht bewusst, welche Art von Wörtern sie denken und sagen und welche Gefühle diese auslösen. Daher wissen sie auch nicht, was die Sprache mit ihnen macht. Doch das kann jeder lernen», bestätigt Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf.
Die Sprachtrainerin empfiehlt folgende Übung:
- Beobachten Sie Ihre Gedanken täglich zweimal während 10 Minuten. Sprechen Sie dabei immer wieder einzelne Gedanken laut und langsam nach;
- Spüren Sie in die emotionale Energie der Wörter hinein, z.B. indem sie einzelne Wörter oder Sätze zweimal aufmerksam wiederholen: «Problem, Problem» oder «Ich habe Stress, ich habe Stress» sowie «Ich freue mich, ich freue mich». Wie fühlen sie sich dabei? Sie werden spüren, dass Wörter Ihre Gemütslage verändern.
Sonja W. machte sich ans Werk: Sie wandelte nach und nach alle Streit- und Kampfwörter in ihrer Alltagssprache um. Zum Beispiel sagte sie von nun an nicht mehr: «Ich muss für alles kämpfen», sondern: «Ich setze mich für vieles ein.» Statt «Dein Zimmer sieht aus als hätte eine Bombe eingeschlagen», sagte sie «Du hast Dein Zimmer noch nicht aufgeräumt.»
Resultat: Sonjas Denk- und Sprechweise wurde harmonischer, ihre Ausstrahlung sanfter und friedlicher. Nach wenigen Wochen erkannte die 35-Jährige erfreut: «Kevin ist ruhiger, und er wird auch kooperativer.»
Doch das war erst der halbe Weg. Durch das Lingva-Eterna®-Sprachtraining war Sonja bewusst geworden, dass sie auch häufig «Sorgen- und Stresswörter» be-nutzte – etwa: «Das ist ein Problem», «Das ist schwierig», «mühsam», «der Verkehr ist stressig» oder «der oder die macht Stress».
Während Sonja den Stress fühlte und von ihm sprach, säte sie ahnungslos die Saat für den nächsten. Kein Wunder, dass der Stress in ihrer Familie zahlreiche Blüten trieb.
Geduldig legte Sonja eins ums andere ihrer Stress- und Sorgenwörter ab – also auch jene Wörter, die einen Mangel an Zeit, Ruhe oder Gelassenheit ausdrücken («Ich habe keine Zeit», «ich muss rasch», «bin unter Druck» usw.). Aus der Formel «Das ist ein Problem» wurde «Das ist eine Herausforderung». Aus dem Satz «Ich bin im Stress!» wurde «Ich habe einen vollen Tag» oder «Ich habe heute zehn Aufgaben. Das ist zu viel. Zwei davon erledige ich morgen.»
Die Wirkung folgte auf dem Fuss: «Zuerst fühlte ich eine Erleichterung», erzählt die 35-Jährige. «Dann liess der Stress spürbar nach. Die grundlegenden Situationen des Alltags blieben zwar gleich, doch ging ich souveräner mit ihnen um.»
Ehe das Jahr um war, hatte sich Kevin deutlich entwickelt: Er hörte besser hin, verhielt sich friedfertiger und verstand sich mit den anderen Kindern so gut, dass er ohne weiteres eingeschult werden konnte.
Ein Einzelfall? Keineswegs. Mechthild von Scheurl-Defersdorf hat viele Väter und Mütter begleitet, die nur deshalb in verfahrenen Situationen steckten, weil sie auf der kommunikativen Leitung standen. Oft lag das an «Kleinigkeiten»: «Damit der kommunikative Strom zwischen Eltern und Kind fliessen kann, muss zunächst der Kontakt hergestellt werden», sagt Frau von Scheurl-Defersdorf.
«Dazu gehört: Reden Sie ihr Kind bei seinem Namen an. So schenken Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit. Nehmen Sie danach Blickkontakt auf. Vergewissern Sie sich, dass auch das Kind Sie anschaut. Formulieren Sie erst dann Ihre Bitte, Frage oder Anordnung. Ist die Situation angespannt, hilft es, einmal gut durchzuatmen, bevor Sie sprechen. Das bringt Sie zurück in Ihre Mitte und bewahrt vor überstürztem Sprechen oder Handeln.»

Mitunter entstehen kommunikative Störgeräusche aber auch ganz woanders. «Fass’ das nicht an», sagt die Mutter genervt zu ihrer kleinen Tochter, die im Supermarkt nach einem Beutel Gummibärchen greift. Daraufhin schnappt sich das Mädchen einen Schokoriegel. «Es gibt jetzt kein Schleckzeugs!», kommentiert die Mutter bissig. Zehn Sekunden später hält das Kind ein Päckchen Kaugummi in den Händen.
Wie steht’s da um die Kommunikation? «Die Mutter gibt dem Kind widersprüchliche Informationen», kommentiert Frau von Scheurl-Defersdorf.
«Zum einen bewirken ‹Tu-das-nicht-Botschaften› das Gegenteil von dem, was die Mutter erreichen will. Genauso gut könnte sie zu dem Kind sagen: ‹Denke jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten› – mit dem Resultat, dass das Mädchen automatisch an einen rosaroten Elefanten denkt.»
Fazit: Erfolgreiches Sprechen ist bejahend und zielorientiert. Die Mutter erreicht ihr Ziel eher mit einem positiven Satz: «Leg’ das zurück ins Regal.»
«Ein weiteres kommunikatives Störgeräusch liegt darin, dass die Mutter in genervtem Ton spricht», unterstreicht Pädagogin von Scheurl-Defersdorf. «Wenn Inhalt und Gefühl in der Stimme konkurrieren, beachtet der Mensch stets das Gefühl stärker. Wie soll sich ein Kind vernünftig verhalten, wenn der Ton der Mutter signalisiert: ‹Du nervst›, ‹Ich habe genug von Dir› »?
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Das leuchtet ein – doch wer verhält sich im Alltag schon immer vorbildlich? Das Familienleben ist reich an Situationen, in denen Kinder wegen einer Bagatelle quengeln, trotzen oder schwer zu beruhigen sind. Was tun, wenn die Sprösslinge beispielsweise dauernd streiten?
«Da sind viele Aspekte wichtig: Die Wertschätzung des Kindes und der eigenen Bedürfnisse, das klare, kraftvolle Sprechen, das Einhalten von Konsequenzen», erwidert Frau von Scheurl-Defersdorf.
Konflikt, Unruhe und Verwirrung können aber auch entstehen, wenn Eltern Bitten, Fragen und Anordnungen vermischen. Wenn Vater oder Mutter beispielsweise genervt zu ihrem Kind sagen: «Deine Spielsachen sind schon wieder überall verstreut!»
Mechthild von Scheurl-Defersdorf: «Das ist keine Anordnung und auch keine Aufforderung. Es ist nur eine Anmerkung, die das Kind nicht dazu bewegen wird, sein Verhalten zu ändern.»
Informationsvernebelnd wirkt auch die Angewohnheit, eine Frage zu stellen, wenn eine Anordnung gemeint ist. Insbesondere Mütter bevorzugen diese «weiche Tour»: «Räumst Du das bitte auf?» oder «Kannst Du das zurück legen?» Gemeint ist jedoch: «Räum’ das auf» oder «Leg das bitte zurück.»
Kurz: Eltern erleichtern sich und ihren Kindern das Leben, wenn sie eine zielorientierte Sprache sprechen. «Wenn sie klare Fragen stellen, klare Bitten äussern, klare Aufträge erteilen und klare Aussagen machen», zieht Mechthild von Scheurl-Defersdorf Bilanz. Zu einer solchen Sprache gehören auch überschaubare Sätze und das Fehlen von Wischiwaschi-Wörtern wie «ich hätte», «ich würde» oder «eigentlich».
Allerdings erreicht auch eine zielorientierte Sprache nicht immer ihr Ziel. Zum Beispiel dann, wenn Eltern ihren Kindern Konsequenzen androhen und sich nicht daran halten.
Die Abneigung gegen Konsequenzen wurzelt tief: «Vielen Eltern fällt es schwer zu ertragen, dass ihre Kinder die Konsequenzen ihres Handelns erleben. Sie betrachten Konsequenzen als hart und sehen darin eine Strafe», beobachtet Frau von Scheurl-Defersdorf. «Das ist nicht so. Eine Konsequenz ist keine Strafe, sondern die logische Folge einer vo-rausgegangenen Handlungsweise.» Mit anderen Worten: Konsequenzen erlauben, Bekanntschaft mit den grundlegenden Gesetzmässigkeiten des Le-bens zu schliessen. Das Kind erfährt, dass sein Handeln immer eine direkte Auswirkung auf es selbst hat. Dadurch lernt es, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
So war das auch bei Antonia B. Ihre drei Kinder im Kindergarten- und frühen Primarschulalter hatten eine ärgerliche Angewohnheit: Jedes Mal, wenn Antonia zum Essen rief, schrie mindestens eins von ihnen zurück: «Gleich!» Zum Essen kamen die Kinder dann aber erst zehn bis fünfzehn Minuten später. Alles Zureden und Ermahnen half nichts.
Eines Tages rief Antonia wieder zum Essen, doch die Kinder spielten fröhlich weiter. Antonia setzte sich an den Tisch, ass eine Portion Salat und räumte dann den ganzen Tisch ab. Nach einer Viertelstunde standen die Kinder vor der Terrassentür. Antonia nahm sie in Empfang und sagte mit möglichst neutraler Stimme: «Kommt herein. Geht gleich hinauf und zieht eure Schlafanzüge an. Das Abendessen ist vorbei. Ihr wart nicht da.»
Völlig verdutzt gingen die Kinder nach oben. Keines maulte, keines versuchte, sich etwas zu essen zu holen. Seitdem kommen sie zum Essen, wenn Antonia sie ruft.
«Das Erleben einer Konsequenz ist nur wenige Male erforderlich», bestätigt von Scheurl-Defersdorf. «Es hilft einem Kind auf Dauer viel mehr als ungezählte Ermahnungen und genervte Blicke der Eltern, die sauer sind, weil sie glauben, alles viele Male sagen zu müssen.»