A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.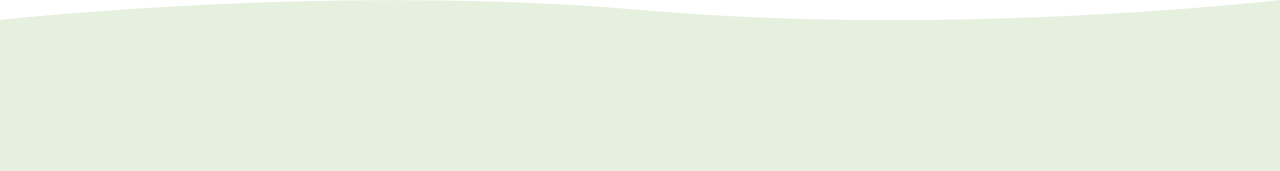
Verdrängte Traumata
Warum es wichtig ist, schlimm Erlebtes bewusst zu verarbeiten.
Unsere Psyche vermag vieles wegzustecken, aber eben nicht alles. Verdrängte traumatische Erlebnisse können zu einer Belastung werden.
Autorin: Nina Mies
Psychologischen Psychotherapeuten begegnet häufig die Frage: «Wieso kommt das jetzt hoch? Das ist doch so lange her!» oder Patienten stellen erstaunt fest: «Ich dachte, ich hätte dieses Thema längst verarbeitet.» Warum ist das so, was steckt dahinter?
Es sei nicht ungewöhnlich, dass Menschen in krisenhaften Situationen offenbar den nachvollziehbaren Wunsch nach ihrem «alten Leben» hegen, als scheinbar alles irgendwie funktioniert hat, weiss Claudia Zier, Psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Freiburg/Breisgau. Doch manchmal komme es eben zu Situationen, die die eigenen momentanen Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen. «Die Psyche versucht so lange wie möglich, Erlebnisse zu verdrängen oder abzuspalten, damit man im Alltag funktionaler ist. Wird dann jedoch eine Tür aufgemacht, weil zu viel auf einmal passiert, geht das nicht mehr», so die Psychotherapeutin. Claudia Zier ist zudem davon überzeugt, dass die Aussage ‹Ich dachte, ich hätte das längst verarbeitet› nicht unbedingt stimmig ist. Manches sei eben nur «pseudo-verarbeitet», indem man sich z.B. bestimmte Verhaltensweisen angeeignet habe, um das Geschehene zu bewältigen. Eine Möglichkeit hierfür ist die Vermeidung in Form von Verdrängung.
Verlusterlebnisse werden häufig verdrängt. «Verdrängen ist ein Schutzmechanismus, so wie wenn wir schweren Ballast abwerfen. Trauergefühle tun weh und deshalb verdrängen wir. Alles was unangenehm ist, wollen wir nicht spüren», erklärt Dr. med. Andrea Fetzner, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. «Manchmal ist es aber auch so, dass wir das gar nicht aushalten können. Wenn etwa ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Tier gestorben sind, tut das so weh, dass wir viel Zeit und Kraft benötigen, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Haben wir jedoch weder Zeit noch die Kraft zur Verarbeitung, dann müssen wir es zunächst wegschieben. Das Problem ist, dass das Verlusterlebnis und die dazugehörigen Gefühle gar nicht wirklich weg sind, sondern gespeichert wurden und später durch eine bestimmte Situation, die entweder an das alte Erlebnis erinnert oder die ähnliche Gefühle wie damals auslöst, wieder präsent werden. Die alte Sache kommt also tatsächlich wieder hoch, auch wenn ich das nicht will.»
Erst, wenn man sich Zeit nehme, die Trauergefühle zuzulassen, könne «die alte Geschichte» verarbeitet werden. «In der Therapie versuchen wir, verdrängte Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, zu spüren, und dann die Gefühle zuzulassen», so Dr. Fetzner.
Das mit dem Verdrängen machen wir also nicht bewusst, sondern das ist häufig erst einmal ein schneller und sehr sinnvoller Schutzmechanismus der Psyche. Wobei es auch Situationen gebe, die man nicht mehr alleine bewältigen könne, z.B. Traumata. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff wie folgt: Ein Trauma ist ein kurz oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von aussergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmass. «Wir unterscheiden Traumatisierung und Traumafolgestörung», erklärt Dr. Andrea Fetzner. «Nicht jeder, der traumatisiert wird, entwickelt auch eine Traumafolgestörung. Normalerweise sprechen wir von Traumatisierung, wenn wir ein lebensbedrohliches Ereignis mitansehen oder selbst miterleben mussten oder Gewalt erlebt haben, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt oder emotionale Gewalt. Trauma bedeutet übersetzt Wunde oder Verletzung.» Ja, vielleicht sei jeder Mensch in gewissem Sinne und zu gewissen Zeiten in seinem Leben verwundet und verletzt. «Das bedeutet aber nicht, dass wir alle eine Traumafolgestörung entwickeln», so Dr. Fetzner. Als Traumafolgestörung werden charateristische Beschwerdebilder bezeichnet, z.B. Angststörungen oder Depression.
«Wir tun zunächst viel dafür, um handlungsfähig zu bleiben. Manchmal ist es auch sinnvoll, belastende Ereignisse, Menschen oder Situationen sozusagen bewusst wegzuschieben», sagt Therapeutin Claudia Zier. Aber wenn die Menschen an dem Punkt sind und ihnen klar wird, dass etwas nicht mehr geht, ist es sinnvoll, dies ernst zu nehmen. «Das Leben führt uns da hin, man sollte es deshalb auch dem Menschen überlassen, da ist die Psyche weiser als wir.»
Die Lebenszeitprävalenz für eine posttraumatische Belastungsstörung, also die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines Lebens an einer Traumafolgestörung zu erkranken, liegt (in Deutschland) in der Allgemeinbevölkerung nach einer Darstellung zwischen 1,5 und 2,3 Prozent (Leitlinien für PTBS). Laut Studien machen weltweit ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung im Lauf ihres Lebens eine traumatische Erfahrung.

Wie bereits festgestellt: Nicht alle, die ein traumatisches Ereignis erlebt haben, entwickeln auch eine Traumafolgestörung. Bei nur etwa einem Viertel der Betroffenen tritt nach dem traumatischen Ereignis eine Traumafolgestörung auf – ausgelöst durch singuläre Ereignisse (Unfall, Naturkatastrophe, Verlust oder Krankheit) oder durch länger dauernde Situationen (wiederholter Missbrauch).
Die Traumata können durch Menschen oder Situationen ausgelöst werden. Zu den Symptomen einer Traumafolgestörung gehören z.B. Flashbacks oder Intrusionen. Das bedeutet, man hat Alpträume oder sich aufdrängende Erinnerungen und Bilder von der belastenden Situation im Kopf, gegen die man sich nicht wehren kann. Manche fühlen sich wie betäubt oder werden gleichgültig gegenüber anderen, sind der Umgebung gegenüber teilnahmslos oder vermeiden dauerhaft Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können.
Meist tritt auch ein Zustand übermässiger Schreckhaftigkeit auf und selbst Suizidgedanken sind nicht selten. «Und da hilft auch erst mal nichts, um das zu verhindern», weiss Claudia Zier. Doch es sei wichtig, dass man ein stabiles soziales Umfeld habe, jemanden, der zuhört, die belastete Person beruhigt, ihr Sicherheit gibt und ihr vor allem glaubt. Manchmal hilft auch nur noch eine Psychotherapie mit Schwerpunkt Traumatherapie bei ausgebildeten Psychotherapeutinnen oder -therapeuten. Es brauche dann vor allem «Mut, auf das zu schauen, was man erlebt hat, um es zu bearbeiten», so Therapeutin Claudia Zier – und das sei eben nicht immer einfach.
«Sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, finde ich grundsätzlich wichtig», so Dr. Fetzner. Aber es gelinge nicht immer und in jeder Lebensphase, solche Themen anzupacken. «Dafür brauchen wir Zeit und Kraft. Doch es lohnt sich immer, Dinge zu verarbeiten und wieder neu Frieden zu finden oder neu anfangen zu können. Zulassen von Gefühlen, zu weinen, zu trauern, wütend zu sein, ist ein wichtiger Schritt zur Verarbeitung von Erlebnissen.»
Ist es nun besser, jedes Erlebnis sofort zu bearbeiten? «Ich würde gar nicht von besser oder schlechter sprechen, manchmal geht es einfach nicht, sich den Lasten zu stellen und dann kann man später im Leben noch daran arbeiten. Es ist nie zu spät, ein schwieriges Erlebnis zu bearbeiten, das kann in jedem Lebensalter erfolgen.»
Doch warum funktionieren Menschen manchmal so lange, bis dann plötzlich subjektiv gar nichts mehr geht? «Das ist tatsächlich ein Phänomen, das viele Menschen vor Rätsel stellt», erläutert Therapeutin Claudia Zier. «Viele wünschen sich, dass das Leben immer so liefe, wie wir es uns vorstellen. Aber es bringt uns manchmal woanders hin. Und das merken manche Menschen nicht direkt, sondern über körperliche Symptome oder emotionale Zustände, die sie von sich ‹normalerweise› nicht kennen.» Gemeint sind vegetative Symptome wie Schwindel, Herzklopfen, Zittern, Schweissausbrüche in überfordernden Situationen oder emotionale Überflutung. Durchaus möglich sei, dass Menschen, denen es so geht, schon länger nicht auf das eigene Erleben gehört und geachtet hätten, sich auch eher dagegen wehren oder die Anzeichen ignorieren. Dabei sei das sehr wichtig, denn «wenn ich nicht spüre, wann mir etwas zu viel ist, kann ich mich auch nicht so gut abgrenzen», so Claudia Zier.
In der Psychologie geht man davon aus, dass es manchmal erst spät zur sogenannten Dekompensation kommt. Das bedeutet, ein Mensch kann im Alltag noch leistungsfähig sein, zur Arbeit gehen, sich um die Familie kümmern und dennoch im Hintergrund bereits eine psychische Störung entwickeln, etwa eine Depression.
Hinter einer Depression steckt auch manchmal ein sogenanntes Bindungstrauma. Dieses entsteht, wenn ein Mensch in dem Bindungssystem, in dem er lebt, wie etwa der Familie, Zurückweisung, Ablehnung oder gar Gewalt in Form von Missbrauch erfährt. «Von einem Bindungstrauma sprechen wir, wenn die Verletzungen und Traumatisierungen im Säuglingsalter und frühen Kleinkindalter geschehen sind, z.B. bevor ein Kind sprechen konnte. Ein Bindungstrauma kann meist nicht bewusst erinnert und auch nicht in Worte gefasst werden. Es wurde keine sichere Bindung aufgebaut. Die Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson ist massiv gestört worden. Das Kind wird kaum in der Lage sein, anderen Menschen zu vertrauen», beschreibt Dr. Fetzner.
Aber auch Mobbing in einer Schulklasse, in einem Verein oder am Arbeitsplatz sind Ursachen, die Traumatisierungen auslösen können. Kann man im Erwachsenenalter verschiedene Belastungen irgendwann nicht mehr kompensieren, kommt es zum Zusammenbruch. Dann geht plötzlich nichts mehr.

Kann man Dinge, die einen sehr belasten, auch bewusst vergessen? In der Traumabehandlung, also wenn Menschen einzelnen oder chronischen Belastungen ausgesetzt waren, geht man vom sogenannten Traumagedächtnis aus. Das bedeutet, dass sich das Gehirn in traumatischen Situationen «zwar etwas merken, es aber nicht integrieren kann», sagt Psychotherapeutin Zier. «Ich erkläre das meinen Patienten immer so: Die traumatische Erinnerung schwimmt wie eine Insel im Gedächtnis umher, wird aber nirgends angehängt, man kommt bewusst nicht dran, jedoch unbewusst, beispielweise über Flashbacks». Oder über Sinneseindrücke, die das Gehirn überfordern. Deshalb sei auch ein Ziel in der Psychotherapie respektive in der Arbeit mit Traumapatienten, die Reduktion von Belastung durch die Integration der Erinnerungen. «Ich habe es noch nie erlebt, dass die Belastung durch die professionelle Bearbeitung so hoch bleibt wie am Anfang. Sie ist vielleicht nach der Therapie nicht immer auf null, aber in der Regel deutlich weniger stark», so Claudia Zier.
Und man könne viel gewinnen. Durch die Bearbeitung der «alten Themen» müsse man Situationen nicht mehr vermeiden, die man vor der Therapie gemieden habe. «Manche können, wenn sie einen Verkehrsunfall erlebt haben oder eine Naturkatastrophe, nicht mehr an den Ort fahren oder vermeiden alles, was damit zu tun hat. Das schränkt auf Dauer ein. Menschen, die durch andere Menschen traumatisiert wurden, z.B. bei einem Banküberfall anwesend waren, gehen unbewusst allen Menschen aus dem Weg, die sie eventuell an den Täter erinnern. Das macht das Leben auf Dauer sehr klein», weiss Therapeutin Zier. In der Psychotherapie wird somit auch versucht, den Handlungsspielraum zu erweitern, sozialen Rückzug zu verhindern und damit Freiheit zurückzugewinnen.
Lassen sich Belastungen, die wieder hochkommen, denn auch bewusst verdrängen? «Ja, natürlich geht das, wenn man keine Zeit hat, an Belastungen zu arbeiten, könnte man Techniken anwenden, bei denen Belastungen weggesperrt und bewusst zu einem späteren Zeitpunkt noch mal angeschaut werden», so Claudia Fetzner. «Es gibt die sogenannte Tresorübung; hier werden belastende Erinnerungen imaginativ in ein sicheres Behältnis gegeben und weggesperrt. Das kann erst mal eine Entlastung sein und zur Stabilisierung beitragen.»
Claudia Zier glaubt zudem an die Idee des Kohärenzerlebens mehr als an den Begriff der Resilienz (Widerstandsfähigkeit). «Ich denke, die Idee, dass es Menschen gibt, die schwierige Situationen besser bewältigen können als andere, ist problematisch.» Getreu dem Motto: Wer mit etwas nicht klarkommt, war nicht resilient genug. Doch letztlich könne es jedem passieren, etwas zu erleben, was er oder sie alleine nicht bewältigen kann.
Nichts im Leben ist sicher. Aber entscheidend ist ein Stück weit die Einstellung gegenüber der Welt, die man langfristig nach belastenden Situationen gegebenenfalls auch ändern sollte. Kohärenz (cohaerere, lat.: zusammenhängen) ist eine Art Lebenseinstellung mit einem Gefühl der Zuversicht, dass aufgrund von Erfahrungen gewisse Entwicklungen vorhersagbar sind und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Angelegenheiten so gut entwickeln, wie man vernünftigerweise erwarten kann.
Dr. Andrea Fetzner ist überzeugt, dass jede Krise auch Potenzial hat, selbst wenn man das im ersten Moment nicht glaubt. «Ich denke, dass in jeder Krise eine Chance zur Veränderung steckt. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung. In jeder Krise gibt es einen Wendepunkt, es muss nicht so weitergehen, wie es bisher war – eine Krise birgt immer die Chance eines Neuanfangs», gibt sie zu bedenken.


