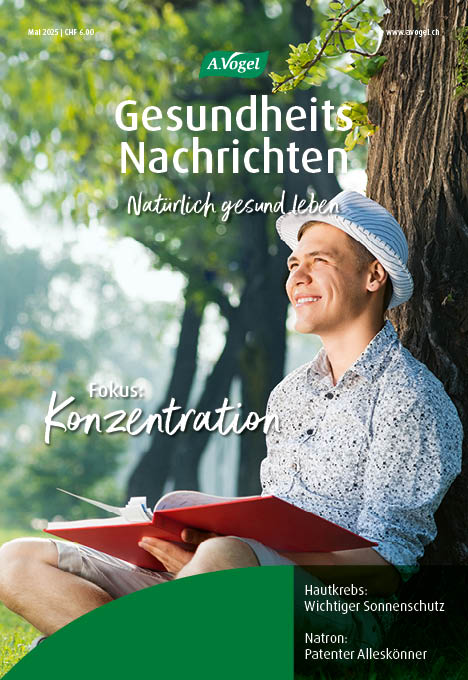A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.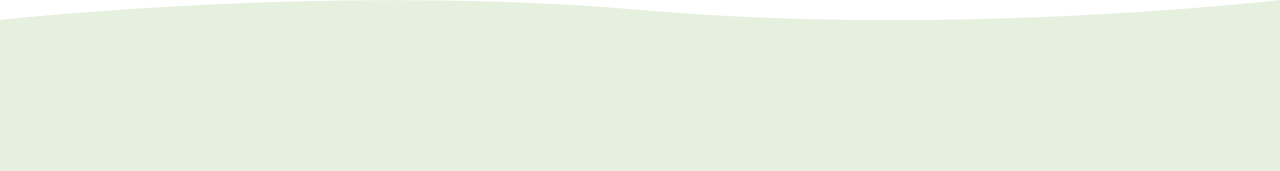
Freundschaft: Ein wahres Gesundheitstonikum
Freunde schützen vor Stress, stärken die Immunabwehr, verlängern das Leben und lassen sogar Hügel schrumpfen. Kurz, Freundschaft ist ein Gesundheitstonikum für (fast) alle Fälle.
Autorin: Petra Horat-Gutmann, 01.16
Es war Freundschaft auf den ersten Blick, als sich Brigitte Maier und Susanne Herzog (Namen geändert) begegneten. «Wir lernten uns an der Berufsschule in Zürich kennen», erinnert sich Brigitte. «Susanne fiel mir schon am ersten Tag auf, weil sie im Unterricht so aufgeweckte Fragen stellte. Das imponierte mir.» Aber auch Brigitte hinterliess Eindruck. «Mit ihrer herzlichen Art wirkte sie von Anfang an wie ein Sonnenschein auf mich», sagt Susanne über ihre Freundin. Das ist 35 Jahre her. Brigitte lebt inzwischen in Basel, Susanne in Bern. All die Jahre sind sie enge Freundinnen geblieben.
Wodurch entstehen solch starke Freundschaften auf den ersten Blick? Das haben Wissenschaftler der California State University kürzlich untersucht. Ihr Fazit: Am wichtigsten für das Entstehen spontaner Freundschaften sind beidseitige Offenheit, gemeinsame Werte, ein ähnlicher Humor, Güte und Aufrichtigkeit.
Das war auch bei Brigitte und Susanne so. Neben ihrem gemeinsamen Interesse für Reisen, Philosophie und fremde Sprachen können sie über die gleichen Dinge lachen, teilen eine ähnliche Sicht aufs Leben und schätzen beidseitig ihre Wesensart.

Die wenigsten Freundschaften bilden sich so rasch wie die von Brigitte und Susanne. Für die gesundheitliche Wirkung der Freundschaft spielt das aber keine Rolle. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Freundschaften die Immunabwehr stärken, über das hormonelle Wechselspiel Herz und Kreislauf stabilisieren, die Lebenszufriedenheit erhöhen und die psychische Gesundheit ausbalancieren.
Die positiven Wirkungen von Freundschaften machen sich bereits in der Kindheit bemerkbar; später kann die Präsenz eines guten Freundes oder einer guten Freundin alle Formen selbstzerstörerischen Verhaltens markant reduzieren, also zum Beispiel Drogenkonsum oder riskantes sexuelles Verhalten.
Um herauszufinden, wie Freundschaft wirkt, bringen Forscher Probanden in unangenehme Situationen. So liess zum Beispiel Dr. Markus Heinrichs, Professor für Biologische Psychologie an der Uni Freiburg, Testpersonen vor Publikum und laufender Kamera Präsentationen halten und danach ohne Vorwarnung Kopfrechenaufgaben lösen.
Das Ergebnis: «Probanden, die ihren besten Freund oder ihre beste Freundin hatten mitbringen dürfen, waren erheblich weniger gestresst als Personen, die allein kommen mussten», berichtet Markus Heinrichs.
Der Forscher mass in ihrem Speichel eine niedrigere Konzentration des Stresshormons Cortisol; die Probanden selbst berichteten über weniger Angst und Unruhe. Und das, obwohl ihre besten Freunde nur während der Vorbereitungsphase anwesend sein durften, nicht beim Test selbst. «Ein Freund, der zehn Minuten an meiner Seite ist, schützt mich über eine Stunde lang wirksam vor Stress», sagt Markus Heinrichs. Überhaupt scheinen Menschen Herausforderungen mutiger und zuversichtlicher anzugehen, wenn ihnen ein vertrauter Freund zur Seite steht.
Das gilt für Lebenskrisen genauso wie für «banale», alltägliche Unternehmungen: Experimente zeigen, dass Testpersonen die Steigung eines Hügels geringer einschätzen, wenn ein Freund an ihrer Seite geht. Sind die Wanderer allein, erscheint ihnen die Anhöhe steiler.
Darüber hinaus beeinflussen Freunde auch die Länge des Lebens, indem sie beispielsweise die Lebenserwartung um rund 22 Prozent bzw. um bis zu 20 Jahre erhöhen, wie eine australische Langzeitstudie an Menschen über 70 zeigt. Danach sollen Freunde die emotionale und psychisch-mentale Gesundheit sogar positiver beeinflussen als die Familie.
Die Forscher vermuten, dass der Gesundheitseffekt auf der freiwilligen gegenseitigen Sorge, Unterstützung und Motivation zum Leben beruht, die mit Freundschaft einhergeht. Eine andere Wohltat von Freundschaft ist ihre Bremswirkung auf den Alterungsprozess des Gehirns. «Die neuronale Aktivität, die durch positive soziale Kontakte gefördert wird, führt zur Bildung von Nervenwachstumsfaktoren – das hält die Nervenzellen jung», erklärt der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Biochemisch ist das Hormon Oxytocin der wichtigste Drahtzieher hinter freundschaftlichen Kontakten. Der als «Frauenhormon» bekannte Wirkstoff leitet die Geburt ein, regt die Milchproduktion an und fördert die Mutter-Kind-Bindung. Doch Forscher haben entdeckt, dass auch Männer ein Oxytocin-System besitzen und dass Oxytocin für beide Geschlechter ein wichtiges «Sozialhormon» ist.
Dazu sagt Prof. Dr. Markus Heinrichs: «Oxytocin wirkt dämpfend auf die Amygdala ein, jene Hirnregion, die uns in Alarmbereitschaft versetzt. Es reduziert die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und nimmt die Angst vor fremden Menschen, schafft also Vertrauen. Im Weiteren aktiviert Oxytocin die Belohnungszentren im Gehirn. Das ruft im engen Kontakt zu anderen Menschen ein angenehmes Gefühl hervor.»

Wenn Partner auch eine freundschaftliche Beziehung zu einander unterhalten, ist das für die Langlebigkeit einer Beziehung von grossem Vorteil.
Freunde waren zu allen Zeiten wichtig. Dennoch gewinne die Freundschaft an Bedeutung, sagen Soziologen, und sie werde tendenziell fürsorglicher. Letzteres äussert sich beispielsweise darin, dass Menschen bereit sind, einen kranken Freund zu pflegen. Oder dass immer mehr Leute mit «Wahlverwandten» unter einem Dach zusammenleben möchten.
An sich ist das wenig erstaunlich in einer Zeit, in der Familienstrukturen brüchig werden und die Geburtenquoten Richtung ein Kind pro Frau sinken.
Parallel dazu wächst übrigens auch das Bewusstsein für Freundschaft in der Ehe. «Verliebtheit und Leidenschaft treten meist irgendwann in den Hintergrund», sagt der Soziologe Janosch Schobin. «Spätestens in diesem Moment wird Freundschaft wichtig. Wenn später die Kinder aus dem Haus sind, entscheidet sich ein Zusammenleben daran, ob ein Paar miteinander befreundet ist oder nicht.»
Ungeachtet der wachsenden Sehnsucht nach Freunden ist die Suche nach denselben oft ein anspruchsvoller Hindernislauf. Zum Beispiel für Leute in wettbewerbsorientierten Berufen. Das hat die Soziologin Sabine Flick von der Goethe-Universität in Frankfurt beobachtet, als sie die privaten Kontakte von Bank- und Versicherungsangestellten analysierte. «Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, am Arbeitsplatz Freunde zu finden, verhindert der Konkurrenz- und Leistungsdruck fast jeden privaten Kontakt», sagt die Forscherin. «Dabei wünschen auch diese Beschäftigten freundschaftliche Beziehungen, in denen sie sich vertrauensvoll öffnen können.»
Was tun? «Freunde zu finden braucht Zeit, Geduld, eigene Initiative oder Vermittlung durch Dritte», sagt der Berliner Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger. Umso mehr, als die meisten Menschen unendlich zurückhaltend seien, was den Beginn von Freundschaften angehe.
Ein optimaler Resonanzboden bestehe aber generell darin, «sich selbst ein guter Freund zu sein», meint Wolfgang Krüger. Auf dieser Grundlage könnten echte Freundschaften zu anderen entstehen. Weitere Qualitäten sind für das Gelingen von Freundschaft wichtig, beispielsweise Offenheit. «Freundschaft lebt davon, dass man sich gegenseitig öffnet», sagt Krüger.
«Eine tiefe emotionale Verbundenheit entsteht, wenn ich dem anderen Dinge sagen kann, die mir auf der Seele brennen, der andere mich versteht und das zurückspiegelt.» Wichtig ist laut Freundschaftsforschern zudem das Gefühl, einander ähnlich zu sein, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, ein aufrichtiges Interesse am anderen und ein ausgewogenes, beidseitiges Sichbemühen um den anderen. All dies erhöht die Chance, dass eine Freundschaft gelingt und sich auch in der Not bewährt.
Manchen Freunden gelingt es gar, in der «Werkstatt» der Freundschaft Fähigkeiten zu schmieden, die weit über die Zweierbeziehung hinausreichen und als homöopathisch-geistige Stimuli den Austausch mit losen Bekannten, Kollegen und Fremden versüssen – etwa in Form von Güte, Kritikfähigkeit und Toleranz.
So jedenfalls ist es Brigitte und Susanne ergangen. «Als es in unserer Freundschaft zu kriseln begann, fühlten wir uns zunächst ratlos, dann entmutigt. Doch schliesslich haben wir unsere Meinungsdifferenzen in langen Gesprächen geduldig analysiert», erinnert sich Brigitte. «Wir haben charakterliche Schwachstellen an uns entdeckt und beschlossen, diese zu bearbeiten, um die Freundschaft wieder ins Lot zu bringen.»
Seither schleife Susanne «an ihrer Toleranz und an einer gütigen Einstellung», auch in Konfliktsituationen. Und Brigitte bemühe sich, Kritik als Lernchance zu sehen, statt gleich zurückzufeuern oder sich beleidigt zu verkriechen.
Ehrlichkeit gilt als Kardinaltugend echter Freundschaft. Zu Recht. Doch wer hätte noch nie beobachtet oder gar selbst erlebt, dass Ehrlichkeit Freundschaften auch zerstören kann? Besonders dann, wenn sie nach dem Motto ausgelebt wird: «Ich bin halt ehrlich, ich sage, was ich denke.»
Zu dieser Umsetzung von Ehrlichkeit schreibt der französische Philosoph Mikhail Aivanhov: «Wie viele Leute nennen jeden Aufruhr ihres Verstandes über alles, was ihnen gefällt oder missfällt, ‹denken›! Wenn sie wirklich denken würden, würden sie schweigen. Oder erst sprechen, nachdem sie sich gefragt haben, was ihre Meinung wert ist, und was die Konsequenzen sein werden, wenn sie ihre Meinung ausdrücken.»