A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.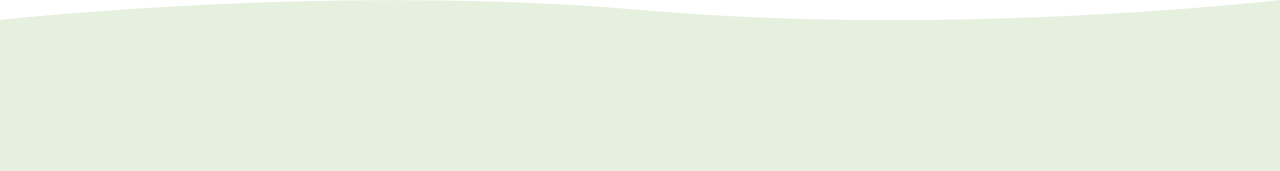
Depressionen Teil 1
Wie ein Mantel aus Blei
Depression bedeutet so viel wie «Niedergeschlagenheit». Das Gefühl, am Boden zu liegen, ist kein Anflug von Melancholie, sondern eine ernst zu nehmende Erkrankung – mit guten Heilungschancen.
«Ich weiss nicht, was mit mir los ist. Ich weiss nur, dass ich nicht mehr kann.» Der junge Chemiker, der mich ins Vertrauen gezogen hatte, sah müde und blass aus. Er könne nicht mehr schlafen, hatte Christian erzählt, morgens komme er kaum aus dem Bett. Er fühle sich schlapp und lustlos, sei seit Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ob er das anstehende Examen überhaupt in Angriff nehmen könne, stehe in den Sternen. Und ob sich das noch lohne, nachdem sein Privatleben ja auch in Scherben liege …
Autorin: Dr. Claudia Rawer
Ohne es zu wissen, hatte Christian mir eine ganze Reihe von «klassischen» Symptomen einer Depression aufgezählt: Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, ein Gefühl von innerer Leere, Selbstzweifel, Angst und Wertlosigkeit.
So weit gekommen war es nach einer anstrengenden Phase der Prüfungsvorbereitung, wobei er sich gleichzeitig Sorgen machte, ob er sein Ziel, mit der Doktorarbeit weiterzumachen, verwirklichen könne, und nachdem seine Freundin ihn verlassen hatte.
Auch das klang fast wie aus dem Lehrbuch: Konkreter Anlass für eine Depression sind häufig schwierige Lebensumstände wie der Verlust eines Angehörigen, die Trennung vom Partner, eine schwere Krankheit, berufliche Überbelastung oder Arbeitslosigkeit.
Eine Depression ist kein «Durchhänger», wie wir ihn alle einmal erleben, und auch kein «Tief» von einigen Tagen oder Wochen. Sie ist eine Krankheit mit psychischen und körperlichen Symptomen, die den gesamten Alltag der Betroffenen verändert. «Wie ein Mantel aus Blei», «ein dunkler See, von dünnem Eis bedeckt», «ein Ungeheuer mit den Fangarmen einer Krake»: So schildern es Betroffene.
Sie sind nicht allein – Depressionen sind viel häufiger, als man allgemein denkt. Schätzungen gehen dahin, dass zwischen 20 und 30 Prozent der Menschen in den Industrieländern zumindest einmal in ihrem Leben an einer Depression erkranken. Bis zum Jahre 2020, so sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO voraus, könnten Depressionen weltweit die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit sein.
Einerseits spricht man von der Depression mittlerweile als «Volkskrankheit», andererseits spricht man gar nicht darüber. «Noch immer (wird) die Frage gestellt, ob Depression eine Krankheit ist», monierte ein Wiener Spezialist im Jahr 2003. «Depression ist noch immer ein grosses Tabu», schrieb die Schweizer «GesundheitSprechstunde» 2005. «Viele spielen Depressionen als Einbildung he-runter» titelt die Stuttgarter Zeitung 2007. Offenbar schreckt der gesunde Mensch heftigst zurück vor der «belastendsten Krankheit, der ein Mensch ausgesetzt sein kann» (WHO). Da ist es hilfreich, wenn Prominente wie der Schweizer Radiomoderator Ruedi Josuran oder der deutsche Fussballer Sebastian Deisler mit ihrer Depression offen umgehen und so mithelfen, der Erkrankung das Stigma zu nehmen.

Foto: Fotolia
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Nicht umsonst erkennen die Hausärzte in 40 Prozent der Fälle die Depression nicht. Das liegt nicht an ihrer Unfähigkeit: Abgesehen von der komplexen und sehr unterschiedlichen Symptomatik klagen die Patienten oft nur über körperliche Symptome, scheuen sich, seelische Prob-leme zuzugeben oder fürchten Nachteile, wenn die wahre Ursache ihrer Be-schwerden bekannt würde.
Dabei können Depressionen lebensbedrohlich sein. Viele depressive Menschen leiden so massiv, dass Selbstverletzungs- und Selbsttötungsgedanken oft genug in die Tat umgesetzt werden. Fast die Hälfte aller von einer Depression Betroffenen begehen einen Selbsttötungsversuch, und zwischen 10 und 15 Prozent aller Personen mit schweren Depressionen nehmen sich tatsächlich das Leben.
Darum ist es für an Depressionen erkrankte Menschen und ihre Freunde und Angehörigen wichtig zu wissen: Es handelt sich tatsächlich um eine Krankheit, mit körperlichen und psychischen Ursachen; es ist eine schwere Erkrankung, die sich im Verhalten, im Gefühlsleben und auf körperlicher Ebene bemerkbar macht und behandelt werden muss. Die Betroffenen bilden sich ihre Krankheit keineswegs ein, sind auch nicht «selbst schuld» an ihrer Lage, weder «Schwächlinge» noch «Versager», und ihnen kann geholfen werden.
Wie Depressionen behandelt werden und wie Angehörige mit den Betroffenen umgehen können, wird ein Beitrag in den «Gesundheits-Nachrichten» De-zember ausführlich schildern. Hier sei so viel gesagt: Leidet ein Ihnen nahestehender Mensch unter dieser Krankheit, verzichten Sie auf gut gemeinte Ratschläge wie «Das wird schon wieder», «Alles halb so schlimm», «Spann doch mal aus» oder gar «Reiss dich doch zusammen!» Weder Zuspruch noch Mahnung werden helfen, sondern den Kranken noch mehr verstören und noch tiefer in Selbstzweifel und Schuldgefühle treiben. Depressionen sind weder mit Willensstärke noch allein mit der Hilfe von Familie und Freunden zu bewältigen.
Die Forscher, die nach den Ursachen der Depression suchen, müssen ein enges Geflecht von biologischen, genetischen und sozialen Faktoren, Lebensgeschichte und Lebenserfahrungen entwirren. Das Rätsel, warum ein Mensch an einer Depression erkrankt und ein anderer bei ähnlichen Lebensumständen gesund bleibt, ist längst noch nicht vollständig gelöst.
Die Neigung, unter Depressionen zu leiden, kann genetisch angelegt sein, zumindest gibt es Hinweise auf eine familiäre Häufung. Allerdings gibt es sicher kein isoliertes «Depressionsgen», vielmehr wohl mehrere Gene, die dafür verantwortlich sind. Entdeckt ist lediglich eine Gen-Variante, die für den Transport der Nervenbotenstoffe Serotonin und Noradrenalin zuständig ist und bei De-pressionen eine Rolle spielen könnte.
Zwillingsstudien zeigen, dass der genetische Faktor nicht allein für die Entstehung einer Depression verantwortlich sein kann, sondern auch familiäre und soziale Verhältnisse eine wesentliche Rolle spielen.
Man weiss auch, dass Menschen im Zusammenspiel all dieser Faktoren un-terschiedliche «Strategien des Lebens» entwickeln: So gibt es z.B. so genannte resiliente Menschen, die in der Lage sind, Krisen im Lebenszyklus zu meistern und als Anlass für ihre Entwicklung zu nutzen; «Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände» nannte es einmal ein Kongress an der ETH Zürich.
Andere sind – oder werden – dünnhäutiger und verletzlicher, was die Fachsprache Vulnerabilität nennt. Vulnerabilität und Stress sind nach Ansicht vieler Forscher die Hauptauslöser einer Depression. Das Alarmsystem des Körpers reagiert, wenn innere Faktoren (z.B. Veränderungen in der Konzentration bestimmter Nervenbotenstoffe) und die Auswirkungen z.B. einer Lebenskrise zu Überbelastung führen.
Man vermutet aber auch, dass unverarbeitete frühe Lebenserfahrungen, wie beispielsweise körperliche oder psychische Misshandlungen, der Tod eines El-ternteils oder eine psychische Erkrankung der Eltern im Hintergrund stehen können, wenn jemand später im Leben eine Depression entwickelt.
Depressionen können jeden treffen und in jedem Alter auftreten. Allerdings er-kranken Frauen doppelt so oft wie Männer – oder es wird bei ihnen doppelt so häufig eine Depression diagnostiziert. Denn Experten gehen davon aus, dass Männer nur andere Bewältigungsstrategien verfolgen, die eine Diagnose er-schweren.
So versuchen sie häufig, nach aussen den Schein des «starken Mannes» zu wahren, können ihre Hilflosigkeit sich selbst und anderen nur sehr schwer eingestehen und sehen den Wunsch nach Hilfe und Unterstützung als Zeichen von Schwäche – mit der Folge, dass sie letztlich ein Doppelleben führen, bei dem der verletzte Teil immer im Verborgenen bleibt. Viele Männer beginnen auch zu trinken. Vom Arzt wird dann oft lediglich das Alkoholproblem therapiert, nicht aber die zugrunde liegende Depression.
Auf grosses Unverständnis der Umgebung trifft häufig eine Depression der Mutter, nachdem ein Kind zur Welt ge-kommen ist. Statt vor Glück zu strahlen, fühlt sie sich traurig und bricht «grundlos» in Tränen aus. Das ist normal: 50 bis 80 Prozent der Mütter erleben nach der Entbindung ein kurzfristiges Stimmungstief, auch als «Babyblues» bekannt. Grund dafür sind die grosse emotionale Anspannung der Geburt und extreme Schwankungen der körpereigenen Hormone. Einige Tage nach der Entbindung fallen die Östrogen- und Progesteronwerte ab, dafür nimmt die Prolaktinproduktion für die Milchbildung stark zu.
Nach ein paar Tagen verschwindet der Babyblues meist von selbst. Hält die negative Grundstimmung aber länger als zwei Wochen an, besteht die Gefahr einer nachgeburtlichen (postpartalen) Depression. Etwa 10 bis 20 Prozent aller Mütter sind davon betroffen.
Auch hier spielen genetische, biochemische, psychische und lebensgeschichtliche Faktoren eine Rolle. Aber das Mutterwerden ist auch eine körperliche und seelische Extremsituation, was oft vergessen wird. Schlafmangel, unerwartete Schwierigkeiten in der Versorgung des Säuglings, aber auch zu hohe Ansprüche der Frauen an sich selbst spielen mit.
Das rosarote Mutter-Image, das in der Gesellschaft weit verbreitet ist, und die Realität stimmen nicht überein; auch dass Frauen selten wie «Muttertiere» funktionieren, sondern Mutter und Kind sich erst einmal kennenlernen und aneinander gewöhnen müssen, wird nicht in Betracht gezogen. Der Alltag läuft plötzlich aus dem Ruder, negative Gefühle wie Trauer, Angst, Wut oder Schmerz werden unterdrückt. Viele Frauen schweigen in einer solchen Situation aus Angst, als Rabenmütter abgestempelt zu werden.
Eine postpartale Depression verschwindet jedoch nicht wie der «Babyblues» nach ein, zwei Wochen. Mutter und Kind brauchen jetzt dringend fachgerechte Unterstützung und Betreuung.
Bereits Kleinkinder können depressiv sein. Fast ein Prozent der Kinder unter sechs Jahren und zwei Prozent der Schulkinder zeigen depressive Verstimmungen, meist, wenn die Beziehung zu den Eltern gestört ist und die Kinder keine oder zu wenig Zuwendung und Geborgenheit erfahren.
Die Symptome sind anders als bei Er-wachsenen: Kinder wirken einfach nur traurig oder apathisch, sind ängstlich und schüchtern, weinen schnell oder reagieren aggressiv, lutschen viel am Daumen, wiegen sich hin und her, haben keine Freude am Spiel, verlieren Gewicht oder nehmen stark zu und bewegen sich un-gern. Je älter die Kinder werden, desto mehr gleichen die Symptome denen von Erwachsenen.
Bereits etwa fünf Prozent der Jugendlichen leiden unter der krankhaften Schwermut. Hier spielen meist psychosoziale Faktoren die Hauptrolle: Überbehütete Kinder, deren Erziehung selbst-sicheres und unabhängiges Verhalten nicht förderte, können ebenso Depressionen entwickeln wie körperlich oder psychisch misshandelte Kinder.
Scheidung oder Tod der Eltern, schulische Über- oder Unterforderung, das Fehlen von Freunden oder ständige Konflikte mit Mitschülern sind häufige Ursachen. Mit der Pubertät als höchst schwierigem Reife- und Ablösungsprozess nimmt die Zahl der Depressionen zu.
Eltern sollten mit ihrem Kind unbedingt professionelle Hilfe suchen, wenn schwerwiegende Probleme in der Schule oder in sozialen Beziehungen entstehen oder Beschwerden wie chronische Schuldgefühle, Müdigkeit, Appetitmangel, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen auftreten. Aus einer amerikanischen Langzeitstudie geht hervor, dass Jugendliche, die an so genannten subklinischen Symptomen leiden – also Symptome, die nicht so ernst zu sein scheinen, dass ein Arzt aufgesucht wird – mit einer zwei- bis dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit wie andere Jugendliche im Erwachsenenleben Depressionen haben werden.

Die Gesundheit lässt nach, das Gedächtnis wird immer schlechter, geliebte Menschen um einen herum sterben – so ist das eben im Alter. Oft aber führen diese Erlebnisse zu einer so genannten Altersdepression. Sie ist häufig: Etwa 15 bis 20 Prozent der Senioren erleben depressive Verstimmungen. Auch bei 30 Prozent aller Demenzkranken treten Depressionen auf, bei bis zu 40 Prozent der Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten, und bei 50 Prozent der Parkinsonkranken.
Eine Altersdepression wird oft nicht er-kannt. Sie weist ähnliche Symptome wie eine Demenzerkrankung auf, Ältere sprechen aus Angst, ihren Mitmenschen zur Last zu fallen, nicht über ihre Schwermut und werten ihr Leiden ab. Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Gewichtsverlust, innere Unruhe und Müdigkeit, Atemnot und Kurzatmigkeit, Angstgefühle oder Einschlafstörungen werden vom Hausarzt oft genug nicht hinterfragt.
Häufig wird die Altersdepression auch als vorübergehende Befindlichkeitsstörung eingestuft. Zu Unrecht, wie die Suizidrate der über 55-Jährigen zeigt: Diese liegt bei Depressionskranken in dieser Altersgruppe um das Vierfache höher als in der Allgemeinbevölkerung, bei Männern und Frauen gleichermassen. Aber auch eine Altersdepression ist – nach gezielter Diagnostik – gut behandelbar, sowohl medikamentös als auch therapeutisch.




