A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.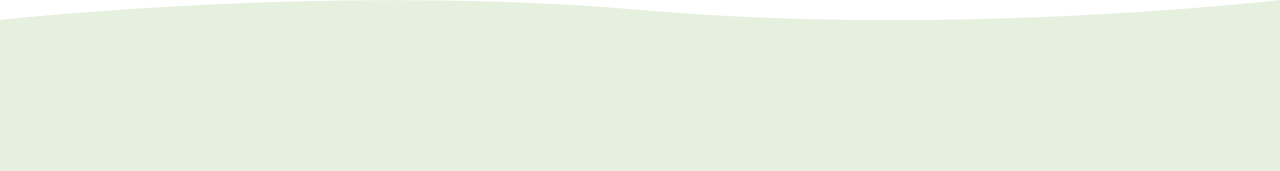
Typisch Frau? Typisch Mann?
Geschlechterrollen
Nicht nur Erziehung und Gesellschaft: Auch die unterschiedliche biologische Ausstattung lässt Männer und Frauen anders ticken. Neue und amüsante Einblicke in die kleinen Unterschiede.
Männer sind rachsüchtiger, lösen Geometrie-Aufgaben leichter und geniessen Spontansex mehr als Frauen. Das weibliche Geschlecht findet eher die richtigen Worte als den richtigen Weg, entwickelt mehr Mitgefühl und verhilft einem Team durch seine soziale Kompetenz zu effizienteren Leistungen als die Herren der Schöpfung.
Autorin: Angelika Eder, 04.12
Derartige Aussagen, oft als politisch inkorrekt verworfen, müssen mit der Einschränkung versehen werden, dass die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sehr viel grösser sein können als zwischen den Geschlechtern. Doch Fakt ist, dass sich heute einige «typisch männliche/typisch weibliche» Eigenschaften und Verhaltensweisen, die man früher als Vorurteil abtat oder einer einseitigen Erziehung zuschrieb, biologisch erklären lassen.
Die neuesten Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Unterschieden sind stetig verfeinerten Untersuchungsmethoden zu verdanken: Ausgeklügelte Verhaltensexperimente, Versuche mit Hormongaben und natürlich die Fortschritte bei den bildgebenden Verfahren wie Ultraschall, Magnetresonanz- und Computertomografie eröffnen Wissenschaftlern immer tiefere Einblicke in jenes Organ, das etwa zwischen 1250 und 1500 Gramm wiegt.

Bei Männern ist das Hirnvolumen tatsächlich grösser – auch wenn man die Masse ins Verhältnis zum Körpergewicht setzt –, aber das Gehirn der Frau zeichnet sich durch eine grössere Oberfläche und günstigere Zellverästelungen aus. Ob Mann, ob Frau – den Hirnhälften kann man dank der genannten Methoden heute sozusagen beim Denken, beim Arbeiten zusehen. Dazu Professor Dr. Roland Sparing, Uniklinik Köln, auf dem jüngsten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung: «Mittels Magnetresonanztomographie (MRT) oder Positronen-Emissionstomographie (PET) veranschaulichen wir, wie sich Sprache im Kindesalter entwickelt oder wie sie sich nach einem Schlaganfall reorganisiert. Die funktionelle Bildgebung ermöglicht uns mittlerweile sogar vorherzusagen, wie die Rehabilitation nach einem Schlaganfall verlaufen wird.»
So ist man längst weit über die Erkenntnisse des Neurobiologen (und Medizin-Nobelpreisträgers 1981) Roger Sperry hinaus, dass räumliches und musikalisches Denken in der rechten Gehirnhälfte angesiedelt sind und analytische und sprachliche Aufgaben im Prinzip in der linken Hemisphäre gelöst werden: Man weiss inzwischen auch, dass die Struktur des weiblichen Gehirns symmetrischer ist, also zwei ungefähr gleiche Gehirnhälften aufweist, während bei den Vertretern des starken Geschlechts die rechte Hemisphäre eher besser ausgebildet ist als die linke. Auf Letztere beschränken sich die Männer übrigens beim Sprachgebrauch, bei dem Frauen beide Hälften nutzen. Deshalb schneiden Frauen bei bestimmten Worttests besser ab, sind weniger anfällig für Stottern oder andere Störungen beim Sprechen und Verstehen und erlangen nach Ausfällen durch Hirninfarkt ihre Sprache eher wieder.
Das Nutzen beider Hirnhälften beim Sprachgebrauch ist laut Gedächtnisexperte Markus Hofmann übrigens auch der Grund dafür, warum es bei Frauen keinen Unterschied macht, mit welchem Ohr sie etwas hören. Anders sei es bei den Männern: Beim Sprechen und Zuhören sind sie auf die linke Hemisphäre beschränkt, in der wiederum Informationen von der rechten Körperhälfte verarbeitet werden. Deshalb rät der Fachmann augenzwinkernd: «Wenn Sie, liebe Leserinnen, also in Zukunft Ihrem Schatz sagen wollen, dass Sie ihn lieben, dann sollten Sie ihm das vorsichtshalber ins rechte Öhrchen flüstern, damit es auch tatsächlich ankommt.»

Dank der zahlreichen faszinierenden Untersuchungsergebnisse zu den Unterschieden der Geschlechter widmete der jüngste Internistenkongress einen Schwerpunkt dem Thema «Gehirn, Hormone und Verhalten von Frauen und Männern». Bevor dort Wissenschaftler zu Wort kamen, berichtete die Schauspielerin und promovierte Ärztin Maria Furtwängler von persönlichen Erfahrungen in puncto «kleiner Unterschied» beziehungsweise Gleichberechtigung: «Mein Ehemann (Verleger Hubert Burda, d. Red.) schafft es bei 70 Prozent weiblichen Angestellten nicht, eine einzige Frau in der Geschäftsführung zu haben», und so trage er dazu bei, dass es in Deutschland «gerade mal katastrophale zwei Prozent Frauen in Führungspositionen gibt». Furtwängler berichtete weiter von ihrem eigenen schlechten räumlichen Orientierungsvermögen und persönlichen Vorurteilen beim ersten Flug mit einer Frau als Pilotin, «weil eine Frau in dieser Funktion in keinem meiner Bücher vorgekommen und kein entsprechendes Bild in meinem Kopf war». Doch bei allem Engagement für Gleichberechtigung: Es führt nichts an der Tatsache vorbei, dass klassische Geschlechtshormone wie Testosteron oder Östrogen das Wahrnehmen und Bewerten von Situationen beeinflussen und sich damit auf das Verhalten auswirken. Ebenso erwiesen ist, dass Erfahrungen das Gehirn verändern.
Wie schwierig sich allerdings biologische und kulturelle Faktoren trennen lassen, zeigte eine Studie an der Ruhr-Universität Bochum zum immer wieder diskutierten Thema «Wer parkt besser ein: Mann oder Frau?» Die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts schnitten dabei eindeutig schlechter ab. Ein Ergebnis, das akzeptiert werden müsse, so der Neurowissenschaftler Professor Dr. Onur Güntürkün, in einem Vortrag in der Bayerischen Staatsbibliothek München, auch wenn man es für politisch inkorrekt halte. Aber er stellte klar, dass der «kleine Unterschied» hier aus Biologie und Kultur resultiere: Der biologische Nachteil der Frauen beim Lösen räumlicher Aufgaben, der sie am Anfang beeinträchtige, verliere mit zunehmender Fahrpraxis an Bedeutung. Doch dann sorgten die Damen höchstpersönlich für schlechtere Leistungen, indem sie sich selbst schlechter einschätzten.
Und noch etwas beeinflusst laut Güntürkün die Studienergebnisse: «Frauen hassen Konkurrenz, Männer lieben sie.» Diese Erklärung scheint absolut zutreffend, beleuchtet man das Ergebnis einer aktuellen britischen Studie: Auf 700 Parkplätzen waren über einen Monat lang etwa 2500 Einparkmanöver gefilmt und rund 2000 Fahrerinnen und Fahrer interviewt worden. Die Auswertung ergab, dass die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts dank langsameren Fahrens schneller eine Lücke entdeckten als Männer, die an einigen erst einmal vorbeirauschten.
Die Frauen stellten ihren Wagen öfter als Männer mittig auf dem Parkplatz ab und parkten zu 39 Prozent nach Fahrschulempfehlung ein, während das nur bei 28 Prozent der Männer verzeichnet wurde. Fazit gemäss Güntürkün: Wenn Frauen nicht als Studienprobandinnen unter Druck stehen und mit anderen konkurrieren müssen, kommen keine typisch weiblichen Selbstzweifel hoch, die die Leistungen schmälern.
Einparken und Selbstvertrauen Die Selbstzweifel zeigten sich ebenso bei Untersuchungen des Belohnungssystems, des «Hauptmotivators unseres Verhaltens». Das unterstrich Professor Hendrik Lehnert, Facharzt für Hormon- und Stoffwechselwirkungen an der Uniklinik Lübeck, auf dem Internistenkongress. Die Aktivierung einer bestimmten Struktur im zentralen Nervensystem vermittelt uns ein maximales Wohlgefühl, das wiederum menschliches Verhalten in extremem Mass prägt. Verglichen wurde die Aktivierung dieses «Nucleus accumbens» bei Männern und Frauen mit Hilfe von Abgabespielen aus der so genannten Verhaltensvolkswirtschaft: Dabei hat Spieler A eine grössere Geldmenge, die er mit B so teilen muss, dass der zufrieden ist und A den Rest überlässt. Entscheidend ist dabei die Frage, ab wann B der Aufteilung von A zustimmt. Erfahrungsgemäss tut er das nur dann, wenn das Verhältnis etwa 1:1 beträgt – und das, obwohl er sich angesichts der Ausgangspositionen eigentlich schon über einen geringeren Betrag freuen müsste.
Entsprechende Versuche zum Thema «Lohngerechtigkeit» zeigten Folgendes: Das Belohnungssystem wird bei Frauen in geringerem Masse aktiviert als bei männlichen Testpersonen, wenn sie für die gleiche Aufgabe mehr Lohn bekommen als ein anderer; die für Empathie zuständige Hirnregion schaltet sich dagegen ausschliesslich bei den Frauen ein. Das kommentierte Lehnert folgendermassen: «Frauen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie in bestimmten Situationen besser wegkommen als andere.
Vielleicht auch ein Grund, warum es für Frauen so schwierig ist, Rollen in Führungspositionen zu akzeptieren, weil sie immer wieder denken: Ich habe das doch gar nicht verdient. Vielleicht gibt es einen Besseren?» Neben den weiblichen Selbstzweifeln zeigten die Experimente noch einen weiteren Unterschied zwischen den Geschlechtern: Die Möglichkeit, den Mitspieler bei (tatsächlich oder vermeintlich) unfairem Verhalten mit einem Stromschlag zu bestrafen, nutzten Männer auffallend öfter und erheblich drastischer als Frauen. Der Internist fasste die Ergebnisse so zusammen: «Die Männer hatten extreme Lust an Rache!», fügte jedoch schmunzelnd hinzu: «Das deckt sich nicht vollständig mit meinen Alltagserfahrungen.»
Die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, stand auch im Mittelpunkt einer Studie, die von Wissenschaftlern in Bonn und Cambridge mit einem Oxytocin-Nasenspray durchgeführt wurde. Diesem Hormon kommt bei der Geburt eine besondere Bedeutung zu: Es löst die Wehen aus und lässt die Milch aus der Brust fliessen, sobald das Baby daran saugt. Darüber hinaus spielt es für die Bindung von Mutter und Kind beziehungsweise zwischen Partnern eine wichtige Rolle und wirkt sich auf Liebe und Vertrauen aus. Besagten Botenstoff verabreichten sich männliche Probanden mittels Nasenspray, die Vergleichsgruppe erhielt lediglich eine Placebo-Substanz. Nach der Hormongabe wurden den Teilnehmern emotionsgeladene Fotos vorgelegt: ein trauernder Mann, ein weinendes Kind oder ein mit Katzen schmusendes Mädchen. Darauf reagierten die Versuchspersonen mit «Kuschelhormon» mit deutlich mehr Mitgefühl als die andere Gruppe. Die Empathiewerte dieser Männer waren so hoch wie die von Frauen.
Die Ergebnisse bestätigten laut Professor Lehnert eindeutig, «dass Frauen und Männer hier unterschiedlich ausgestattet sind». Derartige Unterschiede müssten in der Medizin künftig stärker berücksichtigt werden. So soll Oxytocin nun darauf getestet werden, ob es therapeutisch für Menschen mit Schizophrenie genutzt werden kann. Denn diesen mangelt es infolge ihrer Krankheit oft an sozialer Kontaktfähigkeit.
Ebenso wissenschaftlich erwiesen wie die grössere Empathie der Frauen und deren – übrigens weltweit – schlechteren Leistungen in Geometrie ist etwas, was Feministinnen jahrzehntelang als Vorurteil negierten: Mädchen spielen wohl von Natur aus lieber mit Puppen und Jungen lieber mit Autos und Bällen. Dass dem tatsächlich so ist, zeigten Untersuchungen mit Tieren, «mit männlichen und weiblichen nichtmenschlichen Primaten, um so zwischen Biologie und Kultur unterscheiden zu können», wie Güntürkün erklärte. Ergebnis: Junge Grüne Meerkatzen bevorzugten je nach Geschlecht unterschiedliches Spielzeug. Die weiblichen Tiere griffen sich entweder die Puppen zum Hegen und Pflegen oder sie nutzten Kochtöpfe zum Sammeln. Die männlichen Meerkatzenjungen dagegen bevorzugten eindeutig Bewegungsspiele und damit Bälle sowie Spielzeugautos. So erklärt sich ein anschauliches (wenn auch vielleicht ausgedachtes) Beispiel, das der Gedächtnisexperte Markus Hofmann auf seiner Internetseite erzählt: Eine Mutter, überzeugte Feministin, schenkte ihrer kleinen Tochter statt der gewünschten Puppe ein Feuerwehrauto. Als sie eines Tages ins Kinderzimmer kam, schaukelte dort ihre Kleine das in eine Decke verpackte Fahrzeug in den Armen und sagte: «Keine Angst, kleines Auto, alles wird gut!» Räumliches Denken ist offenbar nicht das Ding der Frauen.
Doch das weibliche Geschlecht kann den Herren der Schöpfung diesen biologischen Vorteil neidlos gönnen, spielen doch räumliches Orientierungsvermögen und die Fähigkeit, schnell und sicher einzuparken, in Zeiten von Navigationsgeräten und Einparkhilfen eine eher untergeordnete Rolle. Das jedenfalls meint die Autorin und damit eine Frau, die das Ergebnis aktueller Untersuchungen der Professoren Anita Woolley und Thomas Malone für sehr viel bedeutsamer hält: An der Carnegie Mellon University, Pittsburgh, kam man zu dem Schluss, dass die Leistungsfähigkeit von Teams beim Bewältigen unterschiedlicher Aufgaben – Brainstorming, Entscheidungsfindung oder Lösen visueller Rätsel – immer mit der Anzahl der Frauen stieg. Nicht aufgrund der Intelligenz der Individuen, so das Fazit der Wissenschaftler, sondern aufgrund der sozialen Sensibilität «waren stets die Teams mit den meisten Frauen am besten!»
- Das Männerhirn ist grösser, aber das Gehirn der Frau zeichnet sich durch eine grössere Oberfläche und günstigere Zellverästelungen aus.
- Das weibliche Gehirn weist zwei gleich grosse Hirnhälften auf. Bei den Männern ist die rechte Gehirnhälfte besser ausgebildet als die linke.
- Männer nützen beim Sprachgebrauch nur die linke Hirnhälfte, Frauen nutzen beide Hälften.
- Frauen hassen die Konkurrenz. Männer lieben Sie.
- Das „Kuschelhormon“ Oxytocin ist für das stärkere Mitgefühl bei den Frauen verantwortlich.
- Mädchen spielen von Natur aus lieber mit Puppen, Jungen lieber mit Autos und Bällen.
- Frauen haben Wechseljahre, Männer haben eine Prostata.


