A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.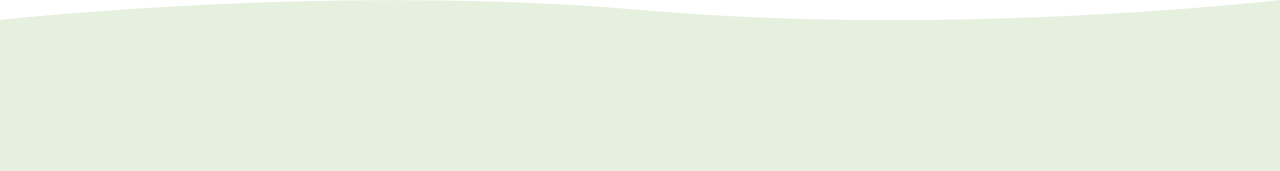
Gender-Medizin: Männer fühlen sich gesünder, Frauen leben länger
Dieselbe Krankheit kann bei einer Frau andere Symptome auslösen als beim Mann, und dieselbe Arznei kann anders wirken. Solche Tatsachen thematisiert die Gender-Medizin: in Prävention, Diagnose und Therapie.
In fast allen Ländern der Welt leben Frauen länger als Männer. Aber Umfragen zufolge fühlen sich Männer gesünder: Sie gehen seltener zum Psychologen und zur Vorsorge und belasten insgesamt das Gesundheitssystem weniger, weil viele nur beim Arzt erscheinen, wenn sonst gar nichts mehr geht.
Autorin: Gisela Dürselen
- Das stärkere Geschlecht?
- Unterschiedlicher Alltag
- Subjektive Gesundheit
- Männer fühlen sich gesünder
- Gleiche Arznei, andere Wirkung
- Der Körper der Frau: ein komplexes System
- Typisch männlich, typisch weiblich?
- Wird die Diagnose bei Männern ernster genommen?
- Beide Geschlechter im Blick
- Prof. Dr. Elisabeth Zemp im Gespräch
Zweimal ein x-Chromosom anstatt der xy-Variante und weibliche Geschlechtshormone statt einer geballten Portion Testosteron: Das macht die Frau zum stärkeren Geschlecht. Denn ihre natürliche Ausstattung schützt sie vor einer Reihe von Leiden, vor allem vor Herz-Kreislaufkrankheiten.
Doch nicht nur biologisch betrachtet wirken unterschiedliche Faktoren auf die Gesundheit von Frau und Mann ein. Das Geschlecht beeinflusst auch Chancen und Belastungen, psychische und finanzielle Ressourcen: Beispielsweise ob jemand Beruf und Familie vereinbaren muss, in Vollzeit oder Teilzeit arbeitet und im Alter arm und verwitwet ist. Das sind die objektiven Lebensbedingungen, die auch über Gesundheit und Krankheit entscheiden.

Darüber hinaus prägt das Geschlecht den persönlichen Lebensstil. Denn wie ein Mensch als Frau oder als Mann zu sein hat, definiert die Gesellschaft in ihrer jeweiligen Zeit und Kultur. Auch wenn sich die typischen Geschlechterrollen fast überall rasant verändern: Der Alltag vieler Frauen und Männer unterscheidet sich noch immer sehr. Frau und Mann gehen anders mit Stress, mit Krankheit und dem Alter um, sie nehmen andere Risiken auf sich und nehmen in unterschiedlichem Mass Hilfe von aussen an. Für ein solches nach Geschlechtern getrenntes Verhalten hat die englische Sprache einen Begriff geprägt: «Gender» – zu Deutsch «das soziale Geschlecht».

Männer verhalten sich beim Sport und im Strassenverkehr riskanter, konsumieren mehr Alkohol, Tabak und illegale Drogen und ernähren sich im Schnitt ungesünder als Frauen. Das konstatierte der erste Gender-Gesundheitsbericht des Schweizerischen Bundesamts für Gesundheit aus dem Jahr 2006. Auch bei Stress gibt es unterschiedliche Bewältigungsmuster: Männer beruhigen sich mit Alkohol, Frauen greifen eher zu Medikamenten.
Die jüngste deutsche Forsa-Umfrage zum Thema «Männergesundheit» aus dem Sommer 2010 bestätigt den Schweizer Befund: 60 Prozent aller deutschen Männer achten zu wenig auf ihre Gesundheit und vernachlässigen zu sehr die Vorsorge.
Gesundheit ist nicht nur ein objektiv messbarer Faktor. Ob sich jemand gesund oder krank fühlt, hängt auch vom persönlichen Erleben ab und davon, wie er Gesundheit definiert: Laut Umfragen verbinden viele Frauen mit Gesundheit ein optimales Mass an psychischem und körperlichem Wohlbefinden. Demgegenüber steht bei Männern – vor allem, wenn sie dem traditionellen Rollenbild entsprechen – die Funktionalität im Mittelpunkt.
«Fasst man wesentliche Unterschiede im Gesundheitsverständnis ?von Männern und Frauen zusammen, so kann man feststellen, dass Männer ihre Gesundheit eher über Aspekte wie Abwesenheit von Krankheit und Leistungsfähigkeit beschreiben, während sich das Gesundheitsverständnis von Frauen weit differenzierter und komplexer darstellt», schreiben die beiden Gesundheitswissenschaftlerinnen Dr. Daphne Hahn und Prof. Dr. Ulrike Maschewsky-Schneider in einem Aufsatz über geschlechterspezifisches Gesundheitsverständnis.
Wenn sich also Männer in Umfragen gesünder fühlen als Frauen, könnte es auch nur sein, dass viele von ihnen ihrer Gesundheit einen anderen Wert beimessen und auf andere Dinge achten als Frauen.

Die Lebensweise wirkt sich auf die Gesundheit aus; der Bezug zum eigenen Körper beeinflusst, wie gesund sich jemand fühlt und in welchem Masse er zum Beispiel die Vorsorge in Anspruch nimmt. Die angeborene Konstitution als Frau und als Mann aber entscheidet darüber, wie Medikamente wirken und wie die Therapie ansetzen muss.
Diese Tatsache wurde im Gesundheitssystem übersehen: Lange Zeit wurden Studien zu neuen Medikamenten fast ausschliesslich an männlichen Probanden mittleren Alters durchgeführt. Die Ergebnisse wurden meist unhinterfragt auf Frauen (und natürlich auch auf jüngere oder ältere Menschen beiderlei Geschlechts) übertragen. Ein Grund dafür lag in der Contergan-Affäre Ende der 1950er Jahre: Danach wurden über lange Jahre hinweg Frauen aus Sicherheitsgründen von den meisten Arzneimittelprüfungen ausgeschlossen.
Es gibt aber noch einen weiteren möglichen Grund für die Einseitigkeit in der medizinischen Forschung: Substanzprüfungen mit Frauen sind weitaus komplizierter als mit Männern.
Wie ein Mensch Medikamente aufnimmt, verarbeitet und wieder ausscheidet, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von Körpergrösse und Gewicht, von der Verteilung von Wasser, Fett und Muskeln im Körper, ebenso von Enzymen und Hormonen. Frauen haben zum Beispiel einen höheren Fettanteil im Gewebe. Darum wirken bei ihnen fettlösliche Substanzen stärker und länger, weil sie optimal gespeichert werden.
Der Körper der Frau ist komplex und das Wissen über Wirkungen und Nebenwirkungen bei Frauen noch immer lückenhaft, sagt Prof. Dr. Elisabeth Zemp im Gespräch (s. Interview weiter unten).
Mit den monatlichen Schwankungen des Hormonspiegels, mit Hormontherapien und Schwangerschaftsverhütung stellt die Frau an sich eine besondere Herausforderung für die Wissenschaftler dar. Denn Hormone beeinflussen den Stoffwechsel und damit die Verarbeitung bestimmter Wirkstoffe. So könnte es zum Beispiel sein, dass Frauen bei bestimmten Medikamenten andere oder zyklusabhängige Dosierungen brauchen. Das macht Substanzprüfungen mit Frauen so langwierig und teuer.

Wenn auf der einen Seite lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass der weibliche Organismus genauso reagiert wie der männliche, so gibt es auch das Gegenteil. Einige Krankheiten gelten als typisch für ein Geschlecht: etwa Ess-Störungen, Depressionen und Osteoporose für Frauen, Herzinfarkt und plötzlicher Herztod sowie Lungenkrebs für Männer.
Die Konzentration auf jeweils ein Geschlecht kann dazu führen, dass die Symptome beim jeweils anderen Geschlecht übersehen, vernachlässigt oder missdeutet werden. So wurde zum Beispiel erst in jüngster Zeit klar, dass auch immer mehr junge Männer an Ess-Störungen leiden. In der Vergangenheit wurden solche Symptome bei vielen nicht als behandlungsrelevant erkannt.
Knochenmasse baut sich auch bei älteren Männern ab: Erst diese Erkenntnis schafft die Voraussetzung dafür, dass die so wichtige Osteoporose-Vorsorge auch bei Männern rechtzeitig beginnt.
Eine einseitige Sicht in Diagnose und Therapie schadet beiden Geschlechtern: «Beim weiblichen Geschlecht werden ganz offensichtlich mehr psychisch bedingte Leiden vermutet. Die Behandlung wird entsprechend ausgerichtet», schreiben die Herausgeber Petra Kolip und Klaus Hurrelmann in dem Buch «Geschlecht, Gesundheit und Krankheit».
Demgegenüber würden körperliche Symptome bei Männern bei der Diagnose im Schnitt ernster genommen als bei Frauen, weil dahinter kein psychisch bedingtes Leiden vermutet werde. Warum sonst werden vor allem Frauen mit Psychopharmaka übertherapiert – und warum bekommen Männer seltener eine Psychotherapie verschrieben, obwohl bei ihnen nachweislich die Selbstmordrate höher liegt als bei Frauen?
Das Gesundheitssystem sollte beide Geschlechter im Blick haben, fordern die Stiftung Männergesundheit und die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit in ihrem ersten deutschen Männergesundheitsbericht vom Oktober 2010. Dabei monieren die Autoren auch, dass in Deutschland zwar seit 2001 ein staatlicher Frauengesundheitsbericht herausgegeben wird, es aber noch immer kein offizielles Pendant für Männer gibt. Frauengesundheitsforschung und -förderung entstand im Gefolge der Frauenbewegung der 1970er- und 80er-Jahre. Eine speziell auf Männer bezogene Gesundheitsförderung ist allerdings fast überall noch ein Randthema.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.

Gespräch mit Prof. Dr. Elisabeth Zemp, Präsidentin des Schweizerischen Forschungsnetzwerks Gender Health. Prof. Dr. Elisabeth Zemp, Medizinerin mit Spezialausbildung in Public Health (Öffentlicher Gesundheit), leitet am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Basel die Forschungsgruppe Gender und Gesundheit. Seit rund 20 Jahren befasst sie sich mit den Auswirkungen von Geschlecht auf die Gesundheit. Schwerpunkte ihrer Forschung sind Frauen- und Geschlechter-Gesundheitsberichterstattung, sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie frauenspezifische Aspekte von Atemwegserkrankungen. Sie leitet das Schweizerische Forschungsnetzwerk Gender Health und ist Präsidentin von PLANeS, der Schweizerischen Stiftung für die sexuelle und reproduktive Gesundheit.
Prof. Elisabeth Zemp hat in der Schweiz das Thema Frau und Gesundheit als eine der ersten aufgegriffen. Für A.Vogel erklärt sie im Interview, warum ein geschlechtersensibles Vorgehen in der Medizin so wichtig ist.
A.Vogel (AV): Männer fühlen sich gesünder als Frauen, sterben aber früher. Wie erklären Sie dieses Paradox?
Prof. Zemp: Kurz gesagt, leiden Männer eher an Krankheiten, die kürzere Überlebenszeiten haben, wie Lungenkrebs. Auch sind bei ihnen gewaltsame Todesfälle häufiger (Unfälle, Suizide).
Bei Frauen finden sich hingegen häufiger als bei Männern Krankheitsbilder, welche mit Beschwerden einhergehen, aber nicht so schnell zum Tod führen, so zum Beispiel rheumatische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Insofern ist dies kein Widerspruch.
Die Bewertung des Gesundheitszustandes mag aber auch mit einem bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägten Gesundheitsbezug und die häufigeren ärztlichen Konsultationen der Frauen mit einer stärkeren Gesundheitssozialisation zusammenhängen. Bei Frauen trägt zudem auch der gynäkologische Bereich zu den häufigeren Konsultationen bei.
AV: Warum gibt es typische «Frauen- und Männerkrankheiten»?
Prof. Zemp: Es gibt eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, die man eher Männern oder Frauen zuschreibt. Diese Zuschreibungen kommen einerseits vor dem Hintergrund unterschiedlicher Häufigkeiten bei Männern und Frauen zustande.
Anderseits trägt aber auch eine zu diesen Krankheiten «passende» Geschlechtervorstellung dazu bei. Psyche «passt» in unseren Vorstellungen besser zu Weiblichem, «Stress» besser zu Männlichem – ob dies im individuellen Fall nun so ist oder nicht. Beides schlägt sich auch bei den diagnostischen Überlegungen nieder, in welchen schneller die entsprechende Zuordnung gemacht wird.
AV: Geben Sie bitte einige Beispiele für die unterschiedliche Wirkungsweise von Medikamenten auf Frauen und Männer.
Prof. Zemp: Es ist noch nicht so lange her, dass man solchen unterschiedlichen Wirkungen – und auch Nebenwirkungen – in der Forschung nachgeht. Das Wissen zu Wirkungen und Nebenwirkungen bei Frauen ist noch immer lückenhaft.
Gut belegt ist eine insgesamt höhere Nebenwirkungsrate. Bezüglich Wirkungen wissen wir beispielsweise, dass Aspirin nur bei Männern zur Prävention von Herzinfarkten beiträgt, hingegen nur bei Frauen zur Prävention von Schlaganfällen. Auch wirken gewisse Schmerzmittel bei Männern stärker, andere bei Frauen.
AV: Die Medizinische Universität Wien bietet seit dem Wintersemester 2010 einen ersten postgraduellen Lehrgang «Gender Medizin» an. Wie steht es um die Entwicklung einer geschlechtersensiblen Medizin in der Schweiz, und welche Rolle spielt dabei das so genannte «Gender Health Netzwerk»?
Prof. Zemp: Gendersensibilität ist in der Medizin noch immer eher punktuell anzutreffen. Erwähnenswert sind Aktivitäten in der Kardiologie, die sich an Frauen und an Fachkreise gerichtet haben, so die Kampagne «Herz & Frau» von der Schweizerischen Herzstiftung. Geschlechtssensibilisierung wird auch im Bereich der Psychiatrie explizit angestrebt.
Zum Thema Männergesundheit wurde ein Buch herausgegeben. Des weiteren integrieren wir immer wieder einzelne Themen in die ärztliche Fortbildung. Das Forschungsnetzwerk «Gender Health» hat seine Schwerpunkte vor allem im Bereich der öffentlichen Gesundheit und vernetzt hier Geschlechterforschende, unter anderem mit jährlichen Veranstaltungen, mit einem Newsletter und einer Informationsplattform




