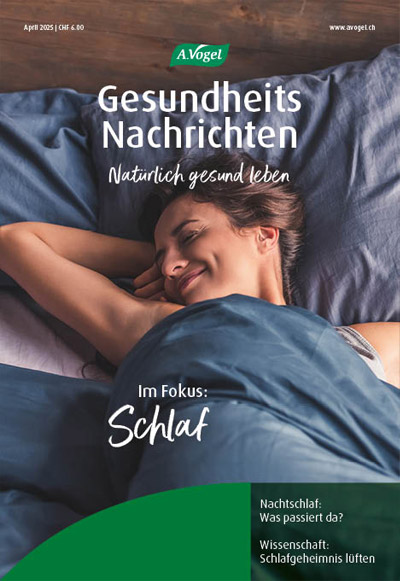A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.
Langlebigkeit und die Folgen
Unsere Lebenserwartung steigt erfreulich. Zugleich entsteht ein düsteres Bild davon, welche gesellschaftlichen Auswirkungen dies haben wird. Ein Blick auf die aktuelle Demografi e-Debatte.
Ein langes, erfülltes Leben führen: Diesen Wunsch hegen wohl die meisten Menschen. Der Traum, gar unsterblich zu sein, ist so alt wie die Menschheit selbst: Regenten und Alchimisten machten sich auf die Suche nach dem «Gral» unendlichen Lebens, mit wenig Erfolg. Dem Tod können wir nicht entrinnen. Doch die durchschnittliche Lebenserwartung steigt – jedenfalls in den Industrienationen – kontinuierlich an, dank besserer Hygiene, gestiegenem Wohlstand und damit gesünderer Ernährung und Fortschritten der Medizin.
Autorin: Judith Dominguez
Spricht man von Kindern oder Jugendlichen, weiss jeder ziemlich genau, von welcher Lebensphase die Rede ist. Doch ab wann ist jemand alt? Ab 70, 80 oder 90 Jahren? Da gesellschaftspolitisch das Alter mit dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben beginnt, biologisch bei den Frauen – je nach Sichtweise – mit den Wechseljahren, sind «alte Menschen» schnell mal zwischen 50 und 100 alt. Das betrifft also gleich mehrere Generationen, denn die 45-jährige Frau im Klimakterium kann ohne Weiteres das Enkelkind einer 100-jährigen Greisin sein.
«Die erhöhte Lebenserwartung der älteren Bevölkerung hat zu einer zeitlichen Ausweitung der nachberuflichen Lebensphase geführt. Dadurch wurde die klassische Zweiteilung in Erwerbsbevölkerung und Altersrentner zu grob», stellt François Höpflinger, emeritierter (2013) Professor der Soziologie an der Universität Zürich, fest. Behelfsmässige Begriffe wie «junge Alte» (Senioren) gegenüber «alte Alte» (Betagte) seien zu wenig differenziert. Es gelte heute, auch zwischen dem dritten und vierten Lebensalter zu unterscheiden und in Kategorien einer Vier-Generationen-Gesellschaft zu denken.
I.
Mit über 40 steht man mitten im Leben und fühlt sich auch so. Gegen die ersten Falten oder die beginnende Glatze benutzt man Pflegeprodukte der Marke Anti-Aging. Man treibt Sport und isst bewusst gesund, um den wachsenden Bauchumfang zu begrenzen. Jede Anspielung aufs Altern weist man weit von sich und glaubt, sich kaum von jungen Erwachsenen zu unterscheiden.
II.
Die jungen Alten haben die 60 überschritten. Entweder arbeiten sie engagiert weiter oder geniessen die neu gewonnene Freiheit. Sie sind mehrheitlich gesund und überzeugt, nie alt zu werden. Sie trainieren fleissig, denn sie wollen fit bleiben und unter keinen Umständen altern. Diese Phase dauert unterschiedlich lang und ist abhängig von psychischen, physischen wie auch finanziellen
Ressourcen – und den Belastungen in früheren Lebensphasen.
III.
Bei den über 80-Jährigen beginnt das vitale Selbstbild zu verblassen. Ganz plötzlich tauchen unangenehme Alterserscheinungen mit zunehmender Intensität auf. Die Partner werden krank, sterben und der Freundeskreis aus Gleichaltrigen schrumpft. Man spricht hier von «fragilisiertem» Alter; die erhöhte Gebrechlichkeit fordert eine Anpassung der Wohnsituation und Unterstützung bei Alltagstätigkeiten.
IV.
Wer diese drei Lebensphasen überlebt hat, wird zu den Hochaltrigen gezählt. Das Risiko gesundheitlicher Probleme, chronischer Erkrankungen und Lebenskrisen steigt mit jedem einzelnen Lebensjahr markant an. Kommen von den 90-Jährigen noch fast die Hälfte ohne pflegerische Leistungen aus, sind es bei den 100-Jährigen nur noch glückliche Ausnahmen. Charakteristisch für die vierte Altersphase ist die gesundheitsbedingte Abhängigkeit, selbstständiges Leben ist kaum noch möglich.
«Es ist diese Lebensphase, welche meist angesprochen wird, wenn negative Stichworte zum Alter angeführt werden», so Prof. Höpflinger.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Die Altersverteilung in der Bevölkerung wird mithilfe einer grafischen Darstellung visualisiert. Die bislang gebräuchliche Pyramidenform, mit einem breiten Sockel vieler junger Menschen und einer schmalen Altersspitze, ist typisch für Entwicklungsländer mit hohen Geburtenraten und niedriger Lebensdauer. In Ländern mit einer hohen Lebenserwartung hingegen ist die Pyramide aus der Form geraten. Die Langlebigkeit lässt die Spitze in die Breite gehen und die Pyramide zur «Urnenform» werden.
Darüber wird heftig diskutiert, bedrohliche Szenarien kursieren. Nicht zuletzt, weil die geburtenstarken Jahrgänge in absehbarer Zeit pensioniert werden. Wie sollen da die Renten finanziert oder die Kostenexplosion im Gesundheitswesen gestoppt werden? Der alte Mensch ist in diesen vielfach emotional geführten Diskussionen zum «Kostentreiber» geworden.
Mit der vielbeschworenen «Überalterung» meinen die Wortführer schlicht, es gebe zu viele alte Menschen. Tatsächlich aber ist der Sockel der Pyramide schmal geworden – es fehlen die Kinder.
Soziologe Höpflinger plädiert, man solle im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel darum treffender von «Unterjüngung» sprechen. An der «Urnenform» wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern. Die Altersspitze verbreitert sich, und der Sockel bleibt schmal. Heute haben Frauen bei der Geburt 84,9 Jahre vor sich und Männer 80,8 Jahre. Schätzungen der AHV zufolge werden es bis 2045 stolze 89,2 Jahre bei Frauen und 86,1 Jahre bei Männern sein.
Altersfreundlich ist unsere Gesellschaft deshalb noch lange nicht. Nach wie vor bestimmt das «Defizit-Modell» des Alterns die öffentliche Diskussion.
Altersforscher werben hingegen schon länger für eine neue Wertschätzung älterer Menschen. Gerade in der «kristallinen Intelligenz» (gesammeltes Wissen) wurde in Studien bei Älteren kein Verfall festgestellt. Dieser Erfahrungsschatz älterer Arbeitnehmer wird momentan schlicht verschenkt. Bei Pro Senectute, der gemeinnützigen Organisation im Dienste der älteren Menschen, ist man überzeugt, dass die über 60-Jährigen eine wichtige Ressource für die Gesellschaft der Zukunft sind. Entsprechend seien die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz umzugestalten: Die Betriebe müssten dafür sorgen, dass die Altersgruppe bis 65 und auch darüber hinaus möglichst gesund und motiviert im Arbeitsprozess integriert bleibe.
Langlebigkeit führt zu längeren Bezugszeiten der Rente – höchste Zeit also, dass bestehende Regeln und Gesetze geändert werden, meint Peter Gross, emeritierter Professor für Soziologie, den die Katastrophenszenarien in punkto Alter ärgern. Die Erwerbstätigkeit müsse verlängert und das Pensionsalter flexibilisiert werden. Dass die Alten auf Kosten der Jungen leben, stimme auch nicht: Das Steuergeld, das die Älteren zahlten, fliesse zum Beispiel in die Bildung und komme damit jüngeren Generationen zugute.
Die gewonnenen Lebensjahre sind ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Alte Menschen tragen durch ihren Konsum von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei, im Gesundheitswesen und im Tourismus beispielsweise.
Andererseits fehlt es zunehmend an Fachkräften, die diese Arbeiten ausführen. Ganz besonders im Gesundheitswesen stellt der ausgetrocknete Arbeitsmarkt eine grosse Herausforderung dar. Vielleicht könnten die jungen Alten diese Lücken füllen und ihr Fachwissen über das Pensionsalter hinaus anbieten. Dies wird aber nur möglich, wenn die Betriebe Menschen über 60 überhaupt einstellen.
Denn ein höheres Rentenalter, wie in vielen Ländern Europas zurzeit gefordert, ergibt nur dann Sinn, wenn in diesen zusätzlichen Jahren tatsächlich gearbeitet werden kann und nicht Arbeitslosenkassen oder Invalidenversicherungen für den Lebensunterhalt aufkommen müssen.
Das nimmt nicht nur die Wirtschaft in die Pflicht, sondern auch die älteren Menschen selbst. Nur wer sich stetig weiterbildet und mit der Entwicklung Schritt hält, kann im Arbeitsleben bestehen. Seit wir dank der Forschung wissen, dass das gesunde Gehirn selbst im hohen Alter lernfähig bleibt, braucht es nur noch eine solide Portion guten Willens. Vorausgesetzt natürlich, man ist körperlich und mental fit.
Wir leben nicht nur mehr Jahre, wir bleiben auch länger gesund. Oder anders ausgedrückt: Wir sterben nicht nur später, sondern wir werden auch später krank und pflegebedürftig. Die Statistik zeigt, dass die Gesundheitskosten erst gegen das 80. Lebensjahr hin stark zunehmen. Die Kosten im letzten Lebensjahr eines Menschen machen ungefähr fünf Prozent der gesamten Gesundheitskosten eines Landes aus. «Die hohen Sterbekosten können auch erklären, weshalb die Gesundheitsausgaben im Querschnitt der Bevölkerung mit dem Alter ansteigen», fasst es das deutsche Bundesgesundheitsblatt von 2012 zusammen.
Nicht zu vernachlässigen in der Rechnung sind natürlich andere Kostentreiber, die nichts mit der Langlebigkeit zu tun haben, wie der technische Fortschritt, die Erwartungshaltung der Patienten, die Ausweitung der Leistungen und neue Medikamente.
Die Politik in der Schweiz hat sich eine Verminderung der steigenden Gesundheitskosten auf die Fahnen geschrieben, und das fast über alle Parteigrenzen hinweg. Kaum thematisiert wird der damit verbundene Abbau der Qualität. Im Gesundheitssektor, ausgenommen die Produktion von medizinischen Geräten, Gebäuden und Medikamenten, sind die Hauptausgaben Personalkosten, also Löhne und Beiträge für die Sozialversicherungen. Da man bereits jetzt einen Mangel an ausgebildetem Pflegepersonal oder Ärzten beklagt, wird eine Lohnreduktion diesen noch verstärken. Belässt man das Lohnniveau, kann mittels Stellenabbau gespart werden. Weniger Personal im Gesundheitswesen hat jedoch direkte Auswirkungen auf die Qualität der Dienstleistungen. Weniger Personal heisst gestresstes Personal, lange Wartezeiten, wenig tröstende Zuwendung und fehlerhafte Arbeitsausführung. Die entscheidende politische Frage ist demnach, ob wir einem solchen kostendämmenden Qualitätsabbau zustimmen wollen.
In der Schweiz leiden laut Angaben des Bundesamtes für Gesundheit rund 2,2 Millionen Menschen an einer oder mehreren chronischen Erkrankungen, das entspricht etwa 80 Prozent der Gesundheitskosten. Dies dürfte in der EU ähnlich aussehen.
Dazu gehören Krebsleiden, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder psychische Störungen. Die Schweiz hat deshalb eine Strategie zur Prävention dieser Krankheiten auf den Weg ge- bracht. Das klingt vernünftig. Je jünger der von einer chronischen Erkrankung betroffene Mensch ist, desto länger werden Gesundheitskosten für medizinische Behandlung, Rehabilitation und Pflege anfallen. Dank Präventionsmassnahmen hofft man, das Risiko für chronische Erkrankungen zu vermindern und das Alter bei Neuerkrankung zu erhöhen.
Gut möglich, dass mit klugen Präventionsmassnahmen viele chronische Erkrankungen verhindert werden können oder erst später im Leben Beschwerden bereiten. Den Alterungsprozess kann man damit aber nicht verhindern und gesund sterben werden wir wohl auch in Zukunft nicht. Man rechnet jedenfalls mit einer Verdreifachung des Bedarfes in der Langzeitpflege bis ins Jahr 2045.
Welche Weichenstellung angesichts dessen die richtige ist, darüber sind sich Fachleute und Politiker längst nicht einig. Altersforscher wie François Höpflinger plädieren für eine gezielte Strategie der
Gesundheitsförderung im höheren Lebensalter. Denn sie könne «die intergenerationelle Belastung einer ansteigenden Hochaltrigkeit in bedeutsamer Weise entschärfen.»
Jedem einzelnen von uns indes bleibt, die gewonnenen Lebensjahre ganz bewusst zu geniessen und diesem Geschenk Priorität einzuräumen. Denn gewonnene Lebenszeit ist unbezahlbar und wertvoll.
Die Lebenserwartung steigt – doch wo liegt die Grenze für die Dauer eines Menschenlebens? Darüber streiten sich die Gelehrten der Forschungsdisziplin Demografie.
Amerikanische Wissenschaftler vom Albert Einstein College in New York veröffentlichten in «Nature» eine neue Studie, die besagt, dass Menschen aus biologischen Gründen wohl nie älter als 125 Jahre werden können.
Dem widerspricht James Vaupel, Direktor des Rostocker Max-Planck-Institutes für Demografie, vehement. Er sieht keinerlei Hinweise auf eine natürliche Obergrenze der Lebenszeit. Das Sterberisiko liege bei Menschen über 110 Jahren in jedem weiteren Lebensjahr bei etwa 50 Prozent und ändere sich nicht mehr, gab er der «ZEIT» Einblick in seine noch nicht veröffentlichte, aktuelle Arbeit. Somit zeichne sich eine lineare Entwicklung in Richtung weiter zunehmendes Alter ab.