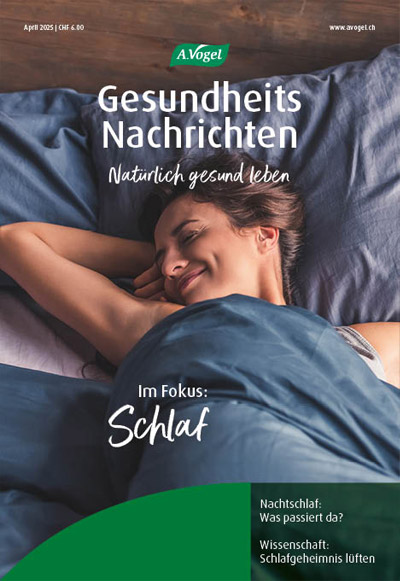A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.
Grippe, Influenza
Symptome, Diagnose und Behandlung
Autorin: Dr. Silke Kerscher-Hack
Als Influenza oder echte Grippe wird eine Infektion mit dem Influenza- bzw. Grippe-Virus bezeichnet, die zu hohem Fieber, schweren Kopf-, Glieder- und Rückenschmerzen sowie trockenem Reizhusten führen kann. Im Unterschied zu Erkältungen oder grippalen Infekten beginnt sie plötzlich mit heftigen Beschwerden, die länger anhalten, und betrifft den gesamten Körper. Influenza-Viren vermehren sich sehr schnell und schädigen dadurch die Schleimhaut der Atemwege. Gleichzeitig schwächen sie die Abwehrkräfte des Körpers und machen diesen anfällig für Komplikationen.
Grippewellen breiten sich normalerweise in den Monaten Dezember bis April aus, da die Wetterbedingungen ihre Übertragung begünstigen: die Grippe-Viren sind bei niedriger Luftfeuchtigkeit und Kälte stabiler. Durch Heizungsluft ausgetrocknete Schleimhäute, ein im Vergleich zum Sommer schwächeres Immunsystem sowie der häufigere Aufenthalt mit anderen Menschen in wenig belüfteten Räumen erhöhen zudem die Ansteckungsrate.
Eine Erkrankung mit Influenz-Viren kann unterschiedlich schwer verlaufen: Von völlig symptomlosen Infektionen (ein Drittel der Infizierten) über leichte Erkrankungsformen (ein Drittel der Infizierten) bis hin zu sehr schweren und sogar tödlichen Verläufen (ein Drittel der Infizierten) ist alles möglich. Für einen an sich gesunden Menschen mit einem intakten Immunsystem ist eine Influenza-Erkrankung jedoch normalerweise nicht lebensgefährlich.
Typischerweise beginnt die echte Grippe nach einer Inkubationszeit von ein bis zwei Tagen plötzlich mit:
- einem starkem Krankheitsgefühl
- Abgeschlagenheit
- Appetitlosigkeit
- hohem Fieber > 38,5 °C
- Schüttelfrost
- Schweissausbrüchen
- Schwindel
- trockenem Husten
- Kopf-, Augen-, Rücken-, Muskel- und Gliederschmerzen
- Halsschmerzen
- Schmerzen hinter dem Brustbein im Bereich der Luftröhre
Nicht immer treten alle Krankheitszeichen auf, da jeder Mensch anders auf eine Grippe-Infektion reagiert. Bei älteren Menschen ähneln die Beschwerden oftmals einer Erkältung und Kinder können auch an Erbrechen und Durchfall leiden.
Auslöser der Grippe-Erkrankung ist der Influenza-Virus A und B. Beide Typen, insbesondere jedoch Typ A, sind veränderlich. Vor allem die beiden Eiweissstoffe Hämagglutinin (H) und Neuraminidase (N) auf der Erregeroberfläche, mit deren Hilfe das Virus in die Körperzellen eindringt, verändern (mutieren) sich stetig ein wenig, so dass das menschliche Immunsystem das Virus bei einer erneuten Infektion nicht mehr erkennt.
Derzeit sind vom Influenza-Virus A 18 Hämagglutinin- und 11 Neuraminidasevarianten bekannt. Bezeichnet werden diese verschiedenen Subtypen nach den Anfangsbuchstaben der beiden Eiweisse auf der Oberfläche. Der Erreger der Vogelgrippe wird beispielsweise Influenza A (H5N1) genannt und jener der Schweinegrippe Influenza A (H1N1). Ein Subtyp von H1N1 war auch der Auslöser der Spanischen Grippe.
Übertragen werden die Viren direkt oder durch Tröpfcheninfektion, d. h. beim Niesen, Husten oder Sprechen gelangen Viren zusammen mit kleinen Tröpfchen aus dem Nasen-Rachen-Raum in die Luft und können von anderen Personen eingeatmet werden. Da die Erreger bis zu mehreren Stunden ausserhalb des Körpers überleben können, ist auch eine Infektion durch mit dem Erreger verunreinigte Gegenstände (z. B. Türklinken) oder durch Händeschütteln und anschliessendem Anfassen, z. B. der Nase, möglich.
An der Wirtszelle angekommen, binden die Viren – über den Eiweissstoff Hämagglutinin in ihrer Hülle – an die Oberfläche der Zelle. Anschliessend schleusen sie ihre Erbinformation ein. Die Wirtszelle produziert nun so lange neue Viren, bis die Neuraminidase die Zellmembran der Wirtszelle zerstört und die Viren freigesetzt werden. Bis zu 100 000 Viren können so an einem Tag hergestellt werden.
Die Behandlung einer Grippe-Infektion erfolgt vorwiegend symptomatisch, d.h., die verabreichten Arzneimittel orientieren sich an den vorhandenen Beschwerden. Fiebersenkende Mittel (Antipyretika) beispielsweise helfen bei hohem Fieber, Schmerzmittel (Analgetika) lindern Glieder- und Kopfschmerzen und Antibiotika kommen bei bakteriellen Sekundärinfektionen (aber nicht gegen die Grippe an sich!) infrage.
Wichtig: Bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren darf im Falle einer Grippeinfektion keine Acetylsalicylsäure gegeben werden, da sonst gefährliche Leber- und Gehirnschäden drohen (Reye Syndrom).
Bei Risikogruppen kann die Gabe von antiviralen Medikamenten, welche die Virusvermehrung hemmen, sinnvoll sein. Diese können den Krankheitsverlauf abschwächen. Möglich sind:
- Neuraminidase-Hemmer, die den Eiweissstoff Neuraminidase hemmen. Diese müssen in den ersten 48 Stunden nach Krankheitsbeginn verabreicht werden.
- M2-Hemmer, die verhindern, dass Virusnukleinsäure aus der infizierten Zelle freigesetzt wird. Die Nukleinsäure enthält den Bauplan für die Eiweisse, die das Virus zur Vermehrung benötigt.
- CAP-Endonuclease-Inhibitoren, die ein bestimmtes Eiweiss (Enzym) hemmen, mit dessen Hilfe das Influenzavirus Kopien von sich selbst produzieren kann.
Um nach einer Grippe-Infektion schnell wieder auf die Beine zu kommen, sollte man
- sich körperlich schonen
- bei Fieber Bettruhe halten
- leicht verdauliche und vitaminreiche Kost zu sich nehmen
- viel trinken, um die verlorene Flüssigkeitsmenge zu ersetzen. Tipp: Bei Grippe sind warme Getränke oftmals wohltuend.
- durchgeschwitzte Bettwäsche und Kleidung wechseln
Begleitend zur medikamentösen Therapie können auch folgende Hausmittel eingesetzt werden, um Beschwerden einer Influenza zu lindern:
- Hühnerbrühe (selbstgekocht)
- Kräutertees mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Ingwer z.B. hemmt Entzündungen und lindert Schmerzen. Spitzwegerich hilft bei Halsschmerzen, Ginseng kann Grippeviren hemmen und die Königskerze wirkt bei Husten reizlindernd.
- Wadenwickel bei Fieber. Bei Schüttelfrost, Frieren oder Kreislaufbeschwerden ist dieses Hausmittel jedoch ungeeignet.
- Zwiebelsirup bei Husten. Dieser wirkt antibakteriell und schleimlösend.
- Inhalieren mit einem Dampfbad oder Vernebler bei Husten und Schnupfen. Der Dampf kann festsitzenden Schleim in der Nase und – im Falle des Verneblers – auch in den Bronchien lösen.
- Gurgeln, z. B. mit Ingredienzen aus Kamille oder Eibisch
- Halswickel mit Zusatz von Quark oder Zitrone bei Halsschmerzen
- Infrarotlicht bei Schmerzen; bei Fieber jedoch nicht anwenden
- warmes Bad mit Zusätzen wie Thymian-, Eukalyptus- oder Latschenkiefernöl bei Gliederschmerzen. Nicht jedoch bei Fieber, da es den Kreislauf belastet.
- pektinhaltige Lebensmittel, wie z. B. Äpfel und Bananen, bei Durchfall.
Nicht jedes Hausmittel ist für jeden geeignet. Aus diesem Grund ist es ratsam, vor der ersten Anwendung mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten.
Influenza-Viren breiten sich sehr häufig über Lunge, Gehirn und Herz aus und können im Prinzip jedes Organ schädigen. Folgende Komplikationen können auftreten:
Bakterielle Superinfektionen, da Bakterien über die geschädigte Atemwegsschleimhaut ungehindert eindringen können. Zu nennen sind hier:
- Lungenentzündungen (häufig) verursacht durch Staphylokokken, Streptokokken, Pneumokokken
- Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
- eitrige Bronchitis
- bei Kindern: Mittelohrentzündungen (Otitis Media)
Des Weiteren sind möglich:
- Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche (Herzinsuffizienz) und in der Folge auch ein Lungenödem, bei dem sich Flüssigkeit in der Lunge ansammelt
- durch das Virus verursachte Lungenentzündungen
- Verschlimmerung vorbestehender Atemwegserkrankungen (z. B. Asthma) bis hin zur respiratorischen Insuffizienz, bei der der Gasaustausch in der Lunge gestört ist.
- Kreislaufschock, Kreislaufversagen
- Leberschwellung, Leibschmerzen
- Durchfälle, Erbrechen
- Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis, Meningitis) oder des Herzmuskels (Myokarditis) (selten)
- bei kleineren Kindern: entzündlicher Befall des Kehlkopfs mit bellendem Husten und Luftnot (Pseudokrupp-Anfälle)
- vor allem bei Kindern: Reye-Syndrom (Erkrankung von Gehirn und Leber) bei gleichzeitiger Einnahme von Acetylsalicylsäure
Normalerweise ist ein Arztbesuch bei Verdacht auf Influenza immer ratsam. Insbesondere, wenn bereits andere Krankheiten bestehen, die das Risiko für Komplikationen erhöhen (z. B. chronische Lungenerkrankungen), oder wenn der Erkrankte Kontakt zu Menschen mit erhöhtem Risiko hat, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Dies gilt auch, wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder das Fieber über 39 °C liegt bzw. lange anhält.
Eine Grippe-Infektion kann so schwer verlaufen, dass sie innerhalb kurzer Zeit zum Tod führen kann. Gefährdet sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder, weil bei ihnen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgereift ist. Ebenso sind Personen über 60 Jahren aufgrund eines schwächeren Abwehrsystems durch eine saisonale Grippe und mögliche Komplikationen besonders gefährdet. Ebenfalls ein höheres Risiko haben Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen der Atemwege, der Niere oder des Herzens sowie immungeschwächte Personen.
Vorbeugende Massnahmen sind:
- gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife sowie anschliessendes Abtrocknen mit einem sauberen Tuch
- Händeschütteln in Zeiten der Grippe-Wellen vermeiden
- Abstand zu erkrankten Personen halten
- keine herumliegenden Taschentücher
- Augen, Mund und Nase nicht mit den Händen berühren, da die Viren auch über die Schleimhäute in den Körper gelangen können
Eine Grippe-Infektion kann bei Kindern völlig untypisch verlaufen. Mögliche Beschwerden sind:
- Bauchschmerzen
- Durchfall
- Übelkeit und/oder Erbrechen
- vermehrte Schläfrigkeit
- Ausschlag: Am ersten Krankheitstag entstehen am vorderen Gaumen stecknadelkopfgrosse Bläschen und an der Wange sowie den Lippen kleine gelblich-weisse Flecken (Grippe-Exanthem)
Aufgrund des noch nicht ausgereiften Immunsystems haben Kinder ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe einer Influenza. In Folge einer Infektion mit Influenza-Viren erkranken sie häufig an einer bakteriellen Superinfektion, wie z. B. einer Mittelohr-, Nebenhöhlen- oder Lungenentzündung, oder erleiden Pseudokrupp-Anfälle. Bei gleichzeitiger Einnahme von Acetylsalicylsäure besteht die Gefahr eines Reye-Syndroms, einer schweren Erkrankung von Gehirn und Leber.
Bei schwangeren Frauen ist die Immunabwehr weniger aktiv, um das ungeborene Kind nicht anzugreifen.
- Sie erkranken dadurch leichter an einer Influenza.
- Ab dem vierten Monat erhöht sich das Risiko für schwere Verläufe einer Influenza.
- Schwangere sind häufiger von Komplikationen betroffen.
- Durch die Grippe-Infektion erhöht sich das Risiko von Fehl- oder Frühgeburten und die Gefahr von Wachstumsverzögerungen des Kindes steigt. Grund hierfür ist, dass Grippe-Viren vermutlich von der Mutter auf das Kind übertragen werden.
Zuletzt aktualisiert: 05-10-2022