A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.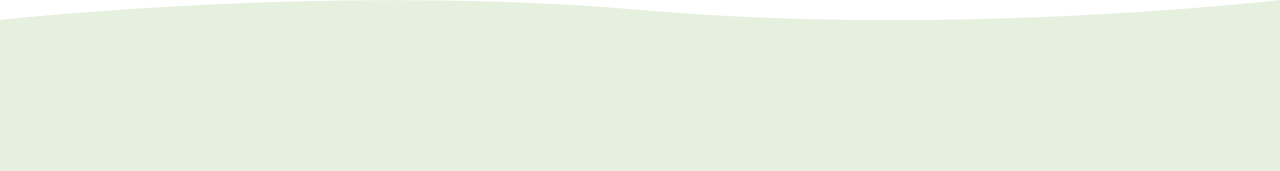
Prostata-Operation
Wie können Männer mit Ängsten und Befürchtungen umgehen?
Empfiehlt der Arzt eine Prostata-Operation, beunruhigt das die meisten Betroffenen. Die Männer machen sich nicht nur Sorgen, ob der Eingriff gut verlaufen wird. Sie haben auch Angst vor eventuellen Spätfolgen wie Inkontinenz oder Potenzproblemen. Das beste Mittel gegen solche Befürchtungen ist, sich ausführlich zu informieren.
Autorin: Annette Willaredt
Die Prostata umschliesst die Harnröhre unterhalb der Blase. Bei jungen Männern ist sie etwa kastaniengross. Etwa ab dem Alter von 30 Jahren vergrössert sich diese Drüse zunehmend. Hat sie eine bestimmte Grösse erreicht, kann sie die Harnröhre einengen. Diese Vergrösserung ist zwar meist gutartig (benigne Prostatahyperplasie). Aber sie führt häufig zu Problemen wie ständigem Harndrang, auch in der Nacht. Der Harnstrahl ist nicht mehr so kräftig wie früher und es tröpfelt auch manchmal nach. Weil die Blase oft nicht mehr vollständig entleert werden kann, leiden die betroffenen Männer nicht selten unter einer Blasenentzündung. Sind die Beschwerden ausgeprägt und belasten den Patienten, wird der Arzt zu einer Operation raten.
Früher wurde das überschüssige Prostatagewebe bei einer gutartigen Vergrösserung noch durch einen Bauchschnitt entfernt. Das ist heute nur noch bei einer sehr stark vergrösserten Prostata nötig. Mittlerweile ist das Standardverfahren die transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P). Dabei wird das störende Gewebe unter Narkose mit einer Elektroschlinge durch die Harnröhre abgetragen. Durch das gleichzeitige Erhitzen dieser Schlinge verschliessen sich die Blutgefäße schnell wieder. Die TUR-P dauert rund 90 Minuten. Nach dem Eingriff muss für ein paar Tage ein Blasenkatheter getragen werden und es ist in der Regel ein Krankenhausaufenthalt von zwei bis sieben Tagen nötig. Studien belegen, dass die Operation die Beschwerden dauerhaft lindern kann. 75 Prozent der Männer haben neun Monate danach nur noch leichte Probleme. Sie müssen z.B. nachts nur noch einmal oder gar nicht mehr raus. Den restlichen 25 Prozent hilft der Eingriff zwar auch, aber nicht so durchschlagend. Eine häufige Nebenwirkung der TUR-P ist der trockene Samenerguss (bei ca. 65 Prozent der Patienten). Dazu kann es kommen, wenn bei dem Eingriff Muskeln leicht verletzt werden, die beim Samenerguss eigentlich den Blasenausgang verschliessen. Dadurch gelangt das Ejakulat in die Harnblase und nicht nach draussen. Das ist zwar völlig harmlos für die Gesundheit und beeinträchtigt auch die sexuellen Funktionen nicht. Aber es setzt die Fruchtbarkeit herab.
Eine grosse Befürchtung vieler Männer sind Erektionsstörungen nach der Operation. Neuen Untersuchungen zufolge kommt es dazu aber nur selten. Auch eine Blasenschwäche (Inkontinenz) tritt manchmal nach dem Eingriff auf. Die ist aber fast in allen Fällen nur vorübergehend.
Neben der TUR-P wird zum Abtragen von überschüssigem Prostatagewebe heute immer häufiger der Laser eingesetzt. Auch hier wird der Eingriff durch die Harnröhre durchgeführt. Studien zufolge sind die Erfolge vergleichbar. Aber meist ist nur ein kürzerer Krankenhausaufenthalt nötig. In Sachen Nebenwirkungen gibt es keine Unterschiede.
Steht einem Mann ein solcher Eingriff bevor, löst das natürlich Ängste aus. Um die in den Griff zu bekommen, sind mehrere Schritte ratsam. Und dazu hat man auch Zeit, denn der grosse Vorteil ist es, dass eine OP zur Behebung einer Prostatavergrösserung keine Eile hat. Schritt eins heißt: Die Ängste bitte nicht in sich hineinfressen. Die Betroffenen sollten auf jeden Fall mit einer nahestehenden Person darüber reden – sei das die Partnerin oder der Partner, ein Familienangehöriger oder ein guter Freund. Das ist nicht nur wichtig, um seelische Unterstützung zu bekommen. Eine Vertrauensperson kann auch beim zweiten Schritt helfen. Der heisst: Sich von seinem Arzt ganz genau erläutern lassen, welche Form der Operation im individuellen Fall richtig ist und welche Nebenwirkungen zu befürchten sind. Sinnvoll ist es zudem, den Arzt zu fragen, in welchen Kliniken die schonendsten Verfahren angewendet werden.

Zu diesem Gespräch nimmt man am besten seine Vertrauensperson mit. Der Grund: Der Betroffene selbst ist bei einem solchen Gespräch meist sehr aufgeregt. Er vergisst vielleicht wichtige Fragen oder kann sich später Zuhause an manche Erklärungen des Arztes nicht erinnern. Hat man sich gründlich informiert, kann ein nahestehender Mensch außerdem dabei helfen, das Für und Wider einer Operation abzuwägen. Nicht zuletzt ist es ratsam, Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen. Das ist meist gar nicht schwer, denn eine gutartige Vergrösserung der Prostata trifft rund die Hälfte der Männer über 50 Jahren. Sich mit anderen Betroffenen austauschen, nimmt viel Angst. Und außerdem bekommt man eventuell auch ein paar gute Tipps, was die Wahl des Arztes oder der Klinik betrifft.
All diese Tipps gelten natürlich auch, wenn der Patient Prostatakrebs hat. Diese Karzinome wachsen zwar meist nur langsam und können dann erst eine Weile beobachtet werden. Trotzdem wird auch in diesem Fall nicht selten eine Operation nötig. Ist der Krebs auf die Prostata beschränkt, wird das Organ meist komplett entfernt. Das kann oft endoskopisch gemacht werden. Dabei schiebt der Chirurg die Instrumente durch winzige Schnitte. In einigen Fällen kann allerdings auch eine Strahlentherapie ausreichen. Ist das Krebsgewebe nicht mehr auf die Prostata begrenzt, kann auch eine offene OP durch einen Schnitt im Unterbauch erforderlich sein. Selbst bei den heutigen, sehr schonenden Methoden müssen die Patienten nach der Operation damit rechnen, zumindest einige Zeit die Blase nicht richtig kontrollieren zu können. Bei vielen Männern wird außerdem die Potenz beeinträchtigt.
Hört ein Mann die Diagnose Prostatakrebs, so stehen oft weniger die Ängste vor der Operation und ihren möglichen Nebenwirkungen im Vordergrund. Vielmehr ist es die Angst vor dem Krebs selbst – und die Frage, ob er heilbar ist. Doch Forscher haben nachgewiesen, dass häufig nicht die Erkrankung selbst die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt, sondern eher das Gefühl, damit alleine zu sein. Darum ist es bei Prostatakrebs doppelt wichtig, mit seinen Angehörigen darüber zu sprechen. Und natürlich auch, Kontakt mit anderen Betroffenen aufzunehmen. Eine gute Möglichkeit sind hier Selbsthilfegruppen, die es in fast jeder Stadt gibt. Zusammen mit anderen, die das gleiche Schicksal teilen, gelingt es oft viel besser, wieder nach vorne zu schauen. Ausserdem ratsam: Die Patienten sollten sich nicht abkapseln, sondern weiter am sozialen Leben teilnehmen, z.B. ins Kino oder ins Theater gehen, wenn möglich Sport treiben und die Hobbys nicht vernachlässigen.

