A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.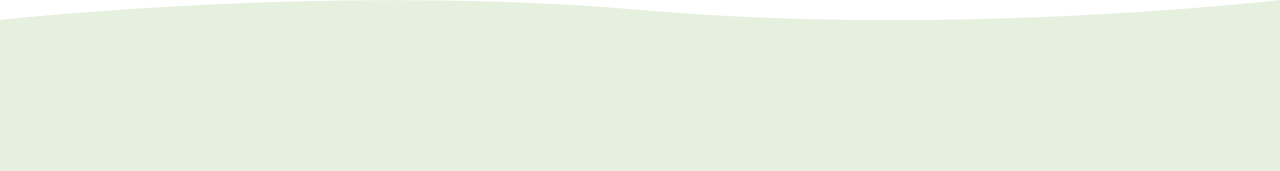
Parkinson-Krankheit
Muskeln ausser Kontrolle
Parkinson ist nach Alzheimer die am weitesten verbreitete Krankheit des Nervensystems. Sie manifestiert sich durch einen fortschreitenden Kontrollverlust der Muskeln, der zu Zittern, Langsamkeit, Steifheit, Gang- und Gleichgewichtsproblemen führt. Sie stellt nicht nur für den Körper eine erhebliche Belastung dar, sondern auch für die Psyche.
Autorin: Ingrid Zehnder, 09.11/10.11
- Rätselhafte Erkrankung
- Parkinsonkranke und die anderen
- Von der Schüttellähmung zu Sir James
- Zweithäufigste Nervenerkrankung
- Ursachen sind nach wie vor ein Rätsel
- Was im Gehirn vorgeht
- Die Hauptsymptome
- Mögliche frühe Zeichen
- Medikamentöse Therapie
- Operation: Die tiefe Hirnstimulation
- Leben mit Parkinson
- Die Diagnose
- Begleitende Therapien
- Gibt es eine Parkinson-Diät?
- Vorsicht mit der indischen Juckbohne
- Wenn der Speichel überläuft
- Sich mit der Erkrankung arrangieren
Während die Alzheimerkrankheit in letzter Zeit breit diskutiert wird, ist Parkinson immer noch eine rätselhafte Erkrankung, über die die Öffentlichkeit wenig weiss. Obwohl die Parkinsonerkrankung Prominenter wie der Politiker Theodore Roosevelt, Mao Tse-tung, Leonid Breschnjev, Manfred Rommel, des Künstlers Salvador Dali, des Boxers Muhammad Ali, des Countrysängers Johnny Cash, des Papstes Johannes Paul II, der Schauspieler(innen) Deborah Kerr, Raimund Harmstorf, Ottfried Fischer und des mit 30 Jahren erkrankten Michael J. Fox Schlagzeilen machte, ist über das Krankheitsbild nach wie vor zu wenig bekannt.
Fast jeder hat schon von der Krankheit gehört, kaum jemand weiss Näheres. Die meisten ordnen der Krankheit das Zittern zu, obwohl das auf ein Drittel der Patienten gar nicht zutrifft.
Betroffene müssen nicht nur mit ihrer Krankheit zurechtkommen, sondern auch mit den Vorurteilen ihrer Umgebung. Sie fürchten die Kritik der anderen, die sich durch das langsam und umständlich wirkende Verhalten der Patienten «genervt» fühlen und nicht selten mit abschätzigen Bemerkungen reagieren.
Sarah L. sagt: «Seit 13 Jahren habe ich die Krankheit, doch stört sie mich weniger als die Blicke der anderen.» Tatsächlich werden das Zittern und die Bewegungsstörungen oft als Folge einer Alkoholsucht missdeutet, was für die Kranken sehr schmerzhaft ist.
Schon der Gelehrte und Staatsmann Wilhelm von Humboldt (1767–1835), der im Alter an Parkinson litt, schrieb: «Das wirklich Schlimme an dieser Krankheit ist nicht nur die tatsächliche Behinderung, sondern die Reaktion der Umwelt; diese erkennt im Verlust der Mimik, der Beweglichkeit, den Sprachstörungen, dem raschen Wechsel von guten und schlechten Phasen nicht die gestörte Motorik als Folge der Krankheit, sondern hält die Symptome für Zeichen eines geistigen Abbaues und vernachlässigt den Patienten als Menschen.»
Fakt ist, dass Stress, Zeitdruck, räumliche Enge und grosse Menschenmengen zu einer Verstärkung der Schwierigkeiten von Parkinsonkranken führen.
1817 beschrieb der englische Arzt James Parkinson als erster die Symptome der Krankheit in einer «Abhandlung über die Schüttellähmung». Der französische Nervenarzt Professor Jean Marie Charcot, einer der Begründer der modernen Neurologie, war 1884 der erste, der die Bedeutung der Arbeit des Londoner Arztes erkannte und den Namen Morbus (Krankheit) Parkinson benutzte. Heute bezeichnen Parkinsonkranke die eigene Krankheit häufig tapfer-ironisch als «Sir James».
Der schwedische Pharmakologe und Nobelpreisträger Arvid Carlsson entdeckte in den 1950er-Jahren den Signalstoff Dopamin und seine Auswirkungen auf die Kontrolle der Bewegungen. Durch die Entwicklung des ersten Medikaments mit dem Wirkstoff Levodopa in den 1970er-Jahren hat die Krankheit viel von ihrem Schrecken verloren.

Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Sie wird als Alterskrankheit bezeichnet, obwohl etwa acht Prozent der Betroffenen vor dem 40. Lebensjahr erste Symptome zeigen. Allein in Deutschland schätzt man 25 000 bis 40 000 Betroffene unter 40 Jahren. Das durchschnittliche Alter bei Krankheitsbeginn liegt aber bei 65 Jahren. Patienten unter 30 sind selten, noch seltener sind unter 20-Jährige. Extrem rar sind Parkinsonkranke im Kindesalter; die jüngste deutsche Patientin war bei den ersten Symptomen 13 Jahre alt.
Zu den Neuerkrankungen pro Jahr und der Erkrankungshäufigkeit existieren viele Studien, deren Ergebnisse jedoch – je nach geographischer Region und untersuchter Bevölkerungsgruppe – stark abweichen. Man geht davon aus, dass in Mitteleuropa und Nordamerika pro Jahr 160 Personen pro 100 000 Einwohner erkranken.
In Deutschland dürften, Schätzungen zufolge, zirka 250 000 Menschen an Parkinson leiden, in der Schweiz sind aktuell rund 15 000 Menschen erkrankt, in Österreich spricht man von 40 000 Patienten.
In der Frage, ob Männer oder Frauen häufiger betroffen seien, sind sich die Forscher nicht einig.
Niedrigere Erkrankungsraten werden bei langjährigen Rauchern und exzessiven Kaffeetrinkern festgestellt. Das könnte daran liegen, dass Nikotin und Koffein den Dopaminspiegel im Gehirn erhöhen. Diese Stoffe bergen andere Gefahren und eignen sich selbstverständlich nicht als Vorbeugemassnahme!
Ein höheres Erkrankungsrisiko wird mit Kopfverletzungen und der berufsbedingten Belastung durch Pestizide assoziiert.
Parkinson kann man behandeln, aber leider bis heute nicht heilen. Bis das Leiden vollständig ausbricht, können Jahre vergehen. Sicher ist, Parkinson schreitet langsam voran und bedeutet keinesfalls automatisch die Frühverrentung, denn in den ersten sieben bis zehn Jahren kann man (je nach Beruf) zweifellos arbeiten. Aufhalten lässt sich die Krankheit aber kaum – irgendwann fallen feinmotorische Handgriffe immer schwerer, bis die Betroffenen zuletzt auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Während die Parkinsonkranken gegen die schleichende, aber stete Einschränkung ihrer motorischen Fähigkeiten kämpfen, bleiben der oder die Auslöser der unheilbaren Krankheit noch weitgehend im Dunkeln.
In eher seltenen Fällen können Mediziner eine Hirnhautentzündung, einen Tumor oder eine Hirnschädigung als Ursache ausmachen. In etwa fünf Prozent der Fälle liegt ein genetischer Defekt vor, der vererbbar ist. Diese so genannten «atypischen» oder «familiären» Parkinson-Syndrome werden anders therapiert als der «idiopathische» Morbus Parkinson, dessen Ursache unbekannt ist und der den überwiegenden Teil der Erkrankungen ausmacht (und von dem dieser Artikel ausschliesslich handelt).

Bei Parkinson gehen die Zellen im Gehirn zugrunde, welche die bewussten und die unwillkürlichen Bewegungsabläufe steuern. Betroffen sind die Basalganglien, Nervenknoten, die für die Kontrolle und Feinabstimmung der Bewegungen zuständig sind. Es handelt sich um ein sehr komplexes Netzwerk mit vielen internen und externen, hemmenden und erregenden Kommunikationsverbindungen. Zu den Basalganglien gehört die Substantia nigra (schwarze Substanz), die wegen ihres hohen Gehalts an Melanin, einem dunkel gefärbten Pigment, so heisst. Heute weiss man, dass die Substantia nigra etwa 400 000 Zellen enthält, die sich kurz nach der Geburt dunkel färben. Diese Nervenzellen sterben auch beim gesunden Menschen im Verlauf des Lebens ab. Jedoch ist bei der Parkinsonerkrankung dieser Zelltod aus bisher ungeklärten Gründen beschleunigt. Studien zeigen, dass zwischen 60 und 80 Prozent der Zellen in der Substantia nigra abgestorben sein müssen, bevor die ersten Beschwerden auftreten.
Die Aufgabe dieser Nervenzellen ist die Produktion des Botenstoffes Dopamin, der für die Kontrolle der Muskelbewegungen verantwortlich ist. Der krankhafte Zellverlust führt dazu, dass zuwenig Dopamin zur Verfügung steht und die Weiterleitung von Signalen im Gehirn gestört ist.
Mit dem Dopaminmangel geht ein relativer Überschuss der Botenstoffe Glutamat und Acetylcholin einher sowie ein Mangel der Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin. Zudem legen neuere Forschungen nahe, dass der Untergang der dopaminproduzierenden Zellen durch eine Art «Müllproblem» mitverursacht wird. Die mangelnde Entsorgung von verbrauchten Strukturen führt dazu, dass sich giftige Abbaustoffe und defekte Bestandteile ansammeln und den Zelltod verursachen.
All diese Veränderungen in den Zellen und bei der Signalübermittlung verursachen nicht nur den Dopaminmangel, sondern auch Störungen, welche das vegetative Nervensystem, den Geruchssinn und Schlafstörungen in der REM-Phase betreffen.

Der Dopaminmangel führt zu vier typischen Parkinsonsymptomen:
> Bradykinese (Verlangsamung der Bewegungen)
Anfangs erscheinen die Bewegungen weniger geschmeidig. Gewohnte, flüssige Bewegungsabläufe, etwa beim Schreiben, Schwimmen, der Körperpflege, Hausarbeit oder handwerklichen Tätigkeiten, gelingen nicht mehr gut und erscheinen irgendwie gehemmt. Die Bradykinese zeigt sich am deutlichsten bei wiederholter Ausführung schneller, entgegengesetzter Bewegungen wie z.B. Öffnen und Schliessen der Faust oder Tippen des Zeigefingers auf den Daumen. Später fällt es schwer, vom Stuhl aufzustehen, im Gehen plötzlich stehen zu bleiben, sich im Bett umzudrehen oder die Kleidung anzuziehen. Auch in der Mimik ist die fortschreitende Bewegungsarmut erkennbar, etwa beim Lachen oder anderen emotionalen Äusserungen. Später entwickeln die Kranken ein ausdrucksloses, starres Maskengesicht («Pokerface»). Die Stimme verändert sich ebenfalls im Laufe der Erkrankung, sie wird leise, monoton und heiser.
> Rigor (Muskelsteifheit)
Die Erhöhung der Muskelspannung beginnt oftmals im Nacken-Schulter-Arm- und im Hüftbereich. Offensichtlich wird der Rigor beim einseitigen, verminderten Mitschwingen des Armes beim Gehen. Die Muskelspannungen und -verkrampfungen können auch ruckartig so zu- und abnehmen, dass sich der Muskel nur stückweise bewegt. Experten sprechen dann vom Zahnradphänomen.
> Tremor (Zittern)
Speziell bei entspannter Muskulatur – in Ruhe – tritt ein regelmässiges, nicht beherrschbares Zittern einer Hand, eines Fusses, des Kiefers, des Kopfes oder gar des ganzen Körpers auf. Auffallend ist, dass das Zittern bei gezielten Bewegungen wie beim Greifen nach Gegenständen verschwindet. Meist ist es einseitig betont, d.h. eine Hand zittert schwächer als die andere oder gar nicht. Ist der Kranke angespannt oder aufgeregt, nimmt der Tremor noch weiter zu. Bei einem Drittel der Erkrankten ist das Zittern jedoch kein vorherrschendes Symptom.
> Posturale Instabilität (Gleichgewichts- und Haltungsstörungen)
Charakteristisch sind die gebückte Haltung mit hängenden Schultern und das Gehen mit kleinen, schlurfenden Schritten. Fast die Hälfte der Kranken erlebt plötzliche Blockaden, die Bewegungen wirken dann wie «eingefroren». Oft ist die Bewegungskontrolle innerhalb weniger Stunden starken Schwankungen unterworfen: Perioden mit annähernd normaler motorischer Funktion wechseln mit Zeiten kompletter Bewegungsunfähigkeit. Das Risiko für Stürze steigt. Letztendlich verlieren die Kranken sogar die Fähigkeit, sich in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bleiben.
Neben diesen sichtbaren Symptomen leiden viele Betroffene auch unter Einschränkungen, die für andere nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Vielen bleiben Depressionen, vermehrter Speichelfluss und Schluckprobleme, Schwitzen, Darmträgheit, gestörte Sexualfunktion, Blasenschwäche und chronische Verstopfung nicht erspart.
Die Diagnose Parkinson hat etwas Unerbittliches, wer sie allerdings in einem frühen Stadium erhält, hat gute Chancen, das Leiden mit Medikamenten über viele Jahre hin beherrschen zu können.
In frühen Phasen der Erkrankung wird geklagt über (einseitige) Muskelschmerzen im Nacken-Schulterbereich, einseitige Muskelverspannung, ruckartige Bewegungen, Müdigkeit, eine gedrückte Grundstimmung und ein vages Gefühl, verlangsamt und erschöpft zu sein. Manche stolpern häufig, lehnen sich beim Gehen weit vor oder halten auf einer Seite den Arm angewinkelt, sodass er nicht mitpendelt. Häufig sind auch unerklärlicher Gewichtsverlust sowie Veränderungen von Stimme und Schrift.
Seit wenigen Jahren weiss man, dass Riechstörungen ein Frühzeichen für Parkinson sein können. Oft ist der Geruchssinn schon Jahre vor dem Ausbruch der Erkrankung vermindert oder verschwunden. Besonders betroffen scheint die Wahrnehmung von Oregano und Vanille.
Die Schlafstörung in der Tiefschlafphase REM (Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung) betrifft etwa 50 Prozent der späteren Parkinsonpatienten, vorwiegend Männer ab etwa 60 Jahren. Die Betroffenen schlagen wild um sich und schreien laut, ohne sich dessen bewusst zu werden. Nicht selten kommt es dabei zu Verletzungen des Träumers selbst oder des Bettnachbarn. Im Gegensatz zu Gesunden wird bei dieser Störung der Nervenimpuls zu den Muskeln während des Tiefschlafs nicht blockiert, sodass die Betroffenen sich bei heftigen Träumen ungehemmt bewegen.
Alle diese genannten Frühsymptome können auch andere Ursachen haben und sind keineswegs zwingend ein Hinweis auf eine künftige oder beginnende Parkinsonerkrankung.
Da man die tieferen Ursachen nicht kennt, lässt sich das Übel nicht an der Wurzel packen. Man kann nur versuchen, den Dopaminmangel auszugleichen und die Begleiterkrankungen, wie z.B. Depressionen, zu behandeln. Nach der Einführung des «Wundermittels» Levodopa oder kurz L-Dopa, einer Vorstufe von Dopamin, die im Gehirn in den Botenstoff umgewandelt wird, konnte der Beginn von ernsteren Behinderungen recht lange hinausgeschoben werden. Die Erfahrung zeigte jedoch, dass die Wirkung von L-Dopa nach etwa 10-jähriger Behandlung nachlässt. Die Patienten müssen dann nicht nur lange auf den Wirkungseintritt des Medikaments warten, sondern werden auch aufgrund stark schwankender Medikamentenspiegel von überschiessenden Bewegungen (Dyskinesien) bzw. langen Blockaden geplagt. Selbst das anfangs gut zu behandelnde Zittern ist auf lange Sicht nicht mehr zufriedenstellend therapierbar.
Deshalb sind die Mediziner dazu übergegangen, das an sich sehr wirksame L-Dopa nur noch Patienten ab dem (biologischen) Alter von 70 Jahren zu verordnen, und auch dabei steht nicht die absolute Symptomfreiheit im Vordergrund, vielmehr gilt die Regel «soviel L-Dopa wie nötig, so wenig L-Dopa wie möglich».
Inzwischen gibt es eine Vielzahl weiterer Medikamente, die die Wirkung von Dopamin nachahmen, seinen Abbau verhindern oder die Konzentration des restlichen Dopamins erhöhen. Sie können allein oder kombiniert mit L-Dopa verabreicht werden.
Die wichtigste Gruppe sind die Dopamin-Agonisten. Das sind Stoffe, die im Gehirn chemisch ähnlich wirken wie Dopamin, deren Wirkung aber nicht so ausgeprägt ist wie die von Levodopa. Seit 2006 ist ein Pflaster mit einem Dopamin-Agonisten auf dem Markt, das den Vorteil einer gleichmässigen Wirkstoffabgabe während 24 Stunden hat.
Aufgrund der genannten Nebenwirkungen in der Langzeitanwendung von L-Dopa versucht man heute besonders bei jüngeren Parkinson-Patienten, die Gabe von Levodopa hinauszuzögern und zunächst mit Dopamin-Agonisten zu behandeln.
Da alle Medikamente nicht nebenwirkungsfrei sind, ist eine gute Information und enge Zusammenarbeit zwischen dem Patienten, seinen Angehörigen und den Ärzten (Hausarzt, Neurologe) absolut notwendig.
In den 70er-Jahren entwickelte der Schweizer Neurochirurg Dr. Jean Siegfried in Zürich die Stimulati-onsmethode und machte sie weltweit erfolgreich. Bei dem Eingriff werden hauchdünne Elektroden durch die Schädeldecke ins Gehirn geführt und mit einem externen programmierbaren Impulsgeber verbunden, der unter dem Schlüsselbein eingesetzt wird. Das auch als «Hirnschrittmacher» bezeichnete Verfahren gilt mittlerweile als eine wirksame Behandlungsmethode, die die Symptome im fortgeschrittenen Parkinson-Stadium bessert. Für den Eingriff kommen nur ausgewählte Patienten (es gibt einige Kontraindikationen) infrage, vor allem jene, die auf Levodopa nicht mehr ausreichend ansprechen oder wegen der hohen Dosierung des Medikaments unter starken Nebenwirkungen leiden. Die Operation kann aber, ebenso wenig wie die Medikamente, die Zerstörung der dopaminproduzierenden Zellen aufhalten.
Die langsam fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die in erster Linie die Beweglichkeit einschränkt, aber auch andere unangenehme «Nebenwirkungen» haben kann, ist nicht heilbar, aber recht gut behandelbar. Verschiedene Therapien können dazu beitragen, dass die Zukunft mit Parkinson lebenswert bleibt.
Parkinson ist nicht gleich Parkinson. Das Fortschreiten der Krankheit und der Grad der Beeinträchtigung verlaufen sehr individuell. Vielen ist ein Leben mit der Krankheit über lange Zeit mit mehr oder weniger starken Einschränkungen, aber in annehmbarer Qualität möglich. Bei anderen, besonders bei jenen, die im Alter über 70 erkranken, schreitet das Ausmass der Behinderungen etwas schneller voran.
Dass die Krankheit fast immer mit unspezifischen Befindlichkeitsstörungen beginnt, macht die Diagnose nicht leicht. Einseitig betonte Muskelverspannungen führen die Betroffenen erst mal zum Rheumatologen. Bei körperlicher Mattigkeit und seelischer Traurigkeit denkt man nicht gleich an Parkinson. Dass die Muskeln steifer werden, kann auch am Alter liegen.
Die Diagnose wird klinisch erstellt, d.h. durch eine gezielte Befragung des Patienten (und eventuell der Angehörigen) sowie eine Untersuchung beim Neurologen. Leitsymptome für die Parkinsonkrankheit sind mindestens zwei der vier Hauptsymptome (siehe GN 9/11): Neben der Verlangsamung der Bewegungsabläufe (Bradykinese) muss eine Muskelsteifheit (Rigor) oder einseitiges Ruhezittern (Tremor) vorliegen. Das vierte Kardinalsymptom, die Gang- und Gleichgewichtsstörungen, tritt meist erst in einem späteren Stadium auf. Ein Test, der die Diagnose mit grosser Wahrscheinlichkeit absichert, ist die Einnahme von L-Dopa. Bessern sich die Krankheitssymptome, wird von einer Parkinson-Krankheit ausgegangen.
Nicht wenige Patienten haben die Erfahrung gemacht, dass eine endgültige Diagnose monatelang dauern kann. Da es keine Tests gibt, welche die Krankheit definitiv nachweisen, wird oft empfohlen, eine zweite Meinung einzuholen bzw. die Diagnose nach einiger Zeit überprüfen zu lassen.
Aufwändige bildgebende Verfahren und nuklearmedizinische Untersuchungen werden eher in Ausnahmefällen und in Abgrenzung zu anderen infrage kommenden Krankheiten eingesetzt.
Eine an die individuellen Bedürfnisse des Patienten bzw. das Krankheitsstadium angepasste Therapie ist von entscheidender Bedeutung für die möglichst lange Selbständigkeit des Patienten im beruflichen und sozialen Umfeld.
Dazu gehört selbstverständlich die medikamentöse Einstellung, was bis zur Optimierung einige Zeit dauern kann und auch immer wieder neu überprüft werden muss.

Die zweite, äusserst wichtige Säule der Behandlung sind Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und psychosoziale Betreuung. Dabei ist eine individuelle Anpassung nötig, je nach Krankheitsstadium, Alter und persönlichen Vorlieben. Diese Begleittherapien stehen heute praktisch überall zur Verfügung. Beim Arzt, in Krankenhaus/Fachklinik oder Rehazentrum werden Betroffene individuell über die geeigneten Massnahmen beraten.
Viele Parkinsonkranke spüren ihr Leiden in Ruhe weniger als bei Bewegung. Deshalb befürchten sie, dass körperliche bzw. sportliche Betätigung ihren Zustand verschlechtern könnte. Diese Sorge ist unbegründet, denn in aller Regel ist das Gegenteil der Fall. Mehr noch: Sport und Bewegung können die Lebensqualität verbessern und sogar eine Linderung der Symptome bewirken.
- Es gibt Parkinson-Sportgruppen, die meist von erfahrenen und speziell ausgebildeten Leitern betreut werden. Regelmässiges Training in der Gruppe schützt vor sozialem Rückzug. Sportliches Training verhindert auch Komplikationen als Folge von Bewegungsmangel, etwa Haltungsschäden, Muskelschwund, Kreislaufschwäche und Atemwegsprobleme.
- Regelmässige Bewegungsübungen unter Anleitung einer Physiotherapeutin und ergänzende Übungen zuhause sorgen für ein besseres Gleichgewicht, stärkere Muskeln und eine stabilere Wirbelsäule. In der Physiotherapie/Krankengymnastik werden Techniken vermittelt, wie sich die krankheitsbedingten Bewegungsblockaden und Starthemmungen überwinden lassen. Je früher man damit anfängt, umso grösser sind die Erfolgsaussichten.
- Tanzen zu rhythmischer Musik fördert nicht nur die Lebensfreude und die sozialen Kontakte, sondern wirkt auch positiv auf die Koordination, das Gleichgewichtsgefühl und die Beweglichkeit. In manchen Städten gibt es spezielle therapeutische Tanzkurse.
- Besonders Jüngere profitieren vom therapeutischen Klettern, das Kondition, Kraft, Hand-, Fuss- und Körperspannung, räumliche Orientierung und Balance trainiert.
- 95 Prozent der Parkinson-Patienten bekommen Probleme mit der Stimme. Häufig merken sie selbst nicht, dass sie leise und monoton sprechen. In der Logopädie werden Stimme, Sprache und das Schlucken geschult.
- Aquajogging oder Wassergymnastik vermindern die eingeschränkte Beweglichkeit und trainieren den Muskelapparat.
- Massagen, Bäder und warme Packungen können die häufig auftretenden Muskelschmerzen lindern.
- Auch die ergotherapeutische Beratung ist von hohem Wert. Sie hilft bei Schreibschwierigkeiten, was besonders für Berufstätige wichtig ist. Und sie unterstützt bei der Auswahl der zahlreich zur Verfügung stehenden Hilfsmittel im Alltag: von Haltegriffen, Sitzauflagen mit nach vorne abfallender Schräge, Toilettensitzerhöhung bis zu abgewinkelten Bestecken mit verbreiterten Griffen.
- Und nicht zuletzt: Besonders in der Anfangsphase ist die psychologische Betreuung von grosser Bedeutung. Einzel- oder Gruppentherapien werden von den Ärzten verordnet und möglichst von Psychologinnen mit Parkinson-Erfahrung durchgeführt.
Lassen Sie sich nichts weismachen: Eine spezifische Diät gibt es nicht. Manchmal wird eine kohlenhydrat-arme Diät empfohlen, manchmal eine eiweissarme.
Die grosse Mehrzahl der Fachleute ist sich allerdings einig, dass es keine Diät gibt, die die Symptome lindert.
Wichtig ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung mit viel frischem Gemüse und Früchten. Da die chronische Verstopfung zu den alltäglichen Problemen von Parkinsonkranken gehört, sollten sie ballaststoffreich essen und möglichst viel trinken.
Nahrungsergänzungen mit Antioxidantien oder den Vitaminen C und E haben keine nachgewiesene günstige Wirkung auf die Beschwerden.
Patienten, die L-Dopa-haltige Medikamente einnehmen, werden von ihrem Arzt Vorschriften über die Einnahme bekommen. Denn zusammen mit einer eiweissreichen Mahlzeit kann die Wirkung dieser Medikamente abgeschwächt werden.
Schluck- und Kauprobleme, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und depressive Gemütslage können dazu führen, dass Parkinsonkranke zu wenig essen und daher abnehmen. Um ein mögliches Untergewicht zu vermeiden, sollten die Betroffenen mit der Ärztin oder dem Ernährungsberater sprechen. Oft macht es Sinn, gemeinsam Speisen zu finden, die sich leicht schlucken lassen.

2010 berichtete die «Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin» in einem Artikel von Dr. Barbara M. Brauckmann (ETH Zürich) und Dr. Klaus Peter Latté (FU Berlin) über L-Dopa aus den Bohnen Vicia faba (Saubohne) und Mucuna pruriens (Juckbohne). Während täglich dreimal 250 Gramm gekochte Saubohnen gegessen werden müssten, enthält das Pulver aus der geschälten Mucuna-Bohne reichlich L-Dopa. Es wird in der ayurvedischen Medizin verwendet, hat aber bei falscher Dosierung fatale Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Bewegungsstörungen, Müdigkeit, Tremor, Durst oder Ohnmachtsanfälle. Nach etlichen Studien an Parkinson-Kranken entstand vor einigen Jahren ein Mucuna-Extrakt, der die Zulassung der indischen Behörden erhielt. Die Autoren des Artikels meinen: «Samenextrakte aus M. pruriens könnten in der zukünftigen Morbus-Parkinson-Therapie eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund des hohen L-Dopa-Gehaltes ist von einer Selbstmedikation …, z.B. als Nahrungsergänzungsmittel, unbedingt abzuraten. Für ein in Europa zugelassenes Arzneimittel müssten die vorliegenden Daten … vervollständigt werden und klinische Studien mit höheren Patientenzahlen vorliegen.»
Auch Dr. Ferenc Fornardi vom Kompetenznetz Parkinson warnt vor Selbstversuchen mit heimischen Acker- bzw. Saubohnen und tropischen Juckbohnen: «Abgesehen davon, dass eine verlässliche Dosierung … mit den Bohnen nicht erreichbar ist, liefern sie nur L-Dopa. Die Therapie mit reinem L-Dopa wurde vor ca. 35 Jahren aufgegeben, weil das L-Dopa ohne Zusatzstoff (Decarboxylase-Hemmer) grösstenteils schon in der Blutbahn verstoffwechselt wird und das Gehirn gar nicht erreicht. Die in der Blutbahn entstehenden Stoffwechselprodukte haben erhebliche Nebenwirkungen ausgelöst, deswegen hat man die moderne L-Dopa-Therapie mit Decarboxylase-Hemmer-Zusatz eingeführt.»
Auf den lästigen Speichelfluss hatte schon Dr. James Parkinson 1817 hingewiesen. Noch heute ist dies ein unangenehmes und oft schwer zu behandelndes Problem. Schuld daran ist nicht eine vermehrte Speichelproduktion, sondern eine Schluckstörung, an der die entsprechenden Muskeln in Mund, Rachen und Kehle beteiligt sind. Wenn die Spucke nicht regelmässig und rechtzeitig geschluckt werden kann, vergrössert sich die Speichelmenge und läuft schliesslich über. Vielen Parkinson-Patienten ist das peinlich, dabei können sie aufgrund ihrer Bewegungsbehinderung den Speichel oft nicht rechtzeitig abwischen.
Der Schock über die Diagnose und die Ungewissheit über die eigene, individuelle Krankheitsentwicklung sind mit Sicherheit schwer zu ertragen. Und doch lehren die Erfahrungen vieler Betroffener, dass es wenig Sinn macht, sich gegen die Krankheit zu stellen.
Der deutsche Schriftsteller Wigand Lange hat sein Buch «Mein Freund Parkinson» betitelt, weil er beschloss, dass dieser Parkinson etwas Gutes sei, so sehr er ihm manchmal auf die Nerven gehe.
Für andere muss es ja nicht gleich eine Freundschaft sein, ihnen hilft vielleicht auch eine mutige Duldung des unabweislichen Begleiters.
Denn auch der Internist und Verhaltensforscher Peter Ubel hat kürzlich in einer US-Studie festgestellt, dass chronisch kranke Menschen, die die Hoffnung auf Heilung aufgeben, glücklicher sind. «Sie hoffen nicht auf die Austeilung besserer Karten, sondern spielen mit den Karten, die sie in der Hand haben.» Sie versuchen, sich mit der unabänderlichen Situation abzufinden und das Beste daraus zu machen.




