A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.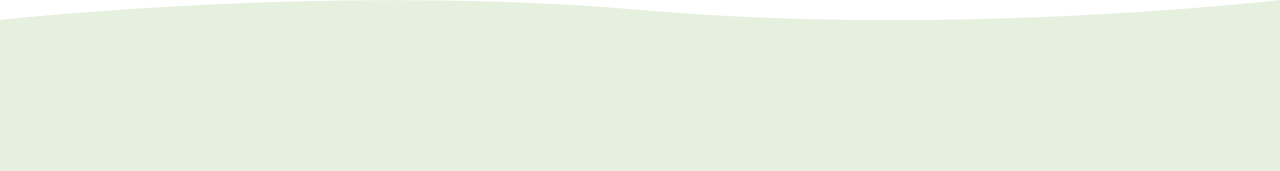
Die Launen des Wetters
Das Wetter und seine «Launen» lassen uns einfach nicht kalt, sind banales Gesprächsthema und gleichzeitig weltbewegende Urkraft. Wetter schreibt Geschichte, macht uns gesund oder krank, und am wärmsten ist es neuerdings mittwochs.
Autorin: Dr. Claudia Rawer
«Alle reden vom Wetter – wir nicht» war einer der erfolgreichsten Werbeslogans aller Zeiten. Immer wieder zitiert, oft parodiert, wurde der Spruch beinahe zum geflügelten Wort. Und dabei reden wir doch so gerne vom Wetter!

Vielleicht macht dies unsere Faszination für das Wetter aus: Wir sind ihm – auch heute noch – ausgeliefert, denn fast alle Versuche, es nach Bedarf zu manipulieren, sind wenig erfolgreich.
Der Mensch hat aus Sumpf Ackerland gemacht, Küsten erweitert, ganze Landschaften neu gestaltet, und neuerdings verändert er selbst die Gene von Pflanzen und Tieren.
Auch das Wetter nach Wunsch zu gestalten, ist ein alter Menschheitstraum. Ungeachtet aller Bemühungen sind die bisherigen Ergebnisse ziemlich bescheiden. So bleiben wir, trotz Zentralheizung und Klimaanlagen, von einer Naturgewalt abhängig, die macht, was sie will.
«Hier ist es ja lausig kalt!» – «Wieso – ich finde es gerade angenehm!» Obwohl das Wetter – von regionalen Unterschieden einmal abgesehen – für alle gleich ist, wird es höchst unterschiedlich wahrgenommen. Stefan wird’s bei 21 Grad schon langsam (zu) warm, während Stefanie bei 25 Grad gerade erst ihre «Betriebstemperatur» erreicht. Wenn Michaela keinen Hund vor die Tür jagen würde, freut sich Michel über den stürmischen Wind, der ihn so richtig durchpustet. Und das Wetter kann es wieder einmal keinem recht machen …
Sogar die Wissenschaft berücksichtigt inzwischen, dass Wetter nicht objektiv wahrgenommen wird. Deswegen werden wir von den Meteorologen neuerdings mit einem neuen Wetterwert beglückt: der «gefühlten» Temperatur.
Dabei geht es allerdings nicht darum, dass Michaela schneller friert als Michel (was daran liegt, dass Männer einen deutlich höheren Muskelanteil haben und Muskeln Wärme produzieren). Unter der gefühlten Temperatur versteht man – vereinfacht gesagt – die von einem Menschen wahrgenommene Umgebungstemperatur, die sich aufgrund verschiedener Faktoren oft stark von der gemessenen Lufttemperatur unterscheiden kann.
Die Windchill-Temperatur (englisch: to chill = abkühlen) bezieht den Wind in die Rechnung ein, denn je stärker der Wind bläst, desto kälter fühlt sich das Wetter für uns an. Bei 0 °C und sehr kräftigem Wind empfinden wir die Temperatur als minus 17 °C.
Die «gefühlte Temperatur» dagegen berücksichtigt neben der Lufttemperatur und der Windgeschwindigkeit auch die Form des Menschen und die Isolation durch die Kleidung. Es handelt sich also um ein Mass für das «thermische Wohlbefinden» und umfasst das Spektrum vom Wärme- bzw. Hitzegefühl über Behaglichkeit bis zum Frieren.
Diesen hochkomplizierten Sachverhalt kann man eigentlich gar nicht in «Grad Celsius» ausdrücken. Tatsächlich handelt es sich um eine Wärmestromdichte, die in Watt pro Quadratmeter gemessen wird. Das versteht aber kaum einer – daher liefern uns die Wetterfrösche im Fernsehen netterweise eine Gradzahl.
… betitelte Alfred Vogel einmal einen Artikel in seiner Zeitschrift "Gesundheits-Nachrichten" über den Einfluss der Wetterlage. Rund 50 Prozent aller Menschen geben an, sie seien wetterfühlig – und haben damit eine besondere Beziehung zum Wetter.
Es gilt mittlerweile als gesichert, dass unser vegetatives Nervensystem auf die Reize des Wetters reagiert. Wie diese allerdings im Detail wirken, ist noch weitgehend unbekannt.
Wahrscheinlich sind es nicht einzelne meteorologische Faktoren, z.B. Nebellagen oder Föhnwinde, die das Wohlbefinden beeinflussen, wie man früher dachte. Vielmehr kommt die Wetterwirkung durch eine ganze Reihe von Einflüssen zustande, unter anderem Luftdruckschwankungen, Sonneneinstrahlung (insbesondere das UV-Licht), Infrarotstrahlung, Feuchtigkeit, elektrostatische und elektromagnetische Felder. Inzwischen versuchen neue Wissenschaftszweige wie Bioklimatologie und Medizinmeteorologie, die komplexen Systeme Mensch und Wetter weiter zu erforschen.
Der Schweizer Meteorologe und Wissenschaftsjournalist Andreas Walker kennt sich beim Thema Wetterfühligkeit bestens aus. Er teilt die Bevölkerung in drei Gruppen ein: Bei den Wetterreagierenden passt sich der Organismus den wechselnden Wetterbedingungen an; sie haben in der Regel keine Beschwerden. Die Wetterfühligen spüren, wenn sich das Wetter ändert und reagieren mit Unwohlsein, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Herzklopfen oder Blutdruckbeschwerden. Die Wetterempfindlichen schliesslich leiden an den Folgen früherer Krankheiten oder Verletzungen; so können sich beispielsweise alte Operationsnarben oder Knochenbrüche bei Wetteränderungen noch nach Jahren schmerzhaft in Erinnerung rufen.
Andreas Walker betont jedoch, dass bei wetterbedingten Beschwerden keine krankhaften Veränderungen an Organen nachgewiesen werden können. Er betrachtet sie als Symptom eines geschwächten Organismus, der nicht in der Lage ist, die atmosphärischen Veränderungen zu kompensieren.
Hochinteressant sind Walkers Analysen bestimmter Wetterlagen und typischer Beschwerden. So erläutert er beispielsweise, dass der Bereich vor und in einer Warmfront aus gesundheitlicher Sicht die folgenreichste Zone ist (und nicht etwa die Föhnwetterlage, die so häufig für die unangenehmen Erscheinungen verantwortlich gemacht wird).
Vereinfacht gesagt, nähert sich uns mit einer Warmfront ein Tiefdruckwirbel, der ein Hoch abbaut, wobei der Luftdruck langsam zu sinken beginnt. Bei einer solchen Wetterlage häufen sich unter anderem Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Schlafstörungen, Angstzustände und depressive Verstimmungen. Oft treten auch Schmerzen an Narben, Phantomschmerzen, Kreislaufbeschwerden durch niedrigen Blutdruck und rheumatische Schmerzen auf.
Mit dem Eintreffen der Warmfront sinkt die Bewölkung immer tiefer, bis ein sanfter, gleichmässiger Landregen einsetzt. Während dieser Wetterphase können sich gesundheitliche Beschwerden noch verstärken. So kommen laut Meteorologe Walker beispielsweise Blinddarmreizungen, Thrombosen, Embolien, aber auch Herzanfälle und -infarkte häufiger als normal vor.
… und das nicht erst heute. So genannte Wetteranomalien traten im Lauf der Jahrhunderte immer wieder auf. So muss im Jahr 1540 in der Schweiz zehn Monate lang Mittelmeerklima geherrscht haben! Der Berner Historiker und Geograph Christian Pfister fand Quellen, nach denen im September mancherorts die Bäume ein zweites Mal blühten und sich noch im Dezember in Schaffhausen junge Burschen im Rhein tummelten.
Zwischen 1685 und 1704 gab es in Europa dagegen eine Kälteperiode: In keinem einzigen Sommer konnte sich ein stabiles Hochdruckgebiet aufbauen. Manche Winter dauerten von November bis April. Und in einer besonders eisigen Januarnacht 1709, als eine Front arktischer Luft innerhalb von Stunden einen Temperatursturz von 30 Grad auslöste, fielen Vögel ohnmächtig zu Boden und Menschen erfroren in ihren Betten.
Oft genug hat das Wetter den Verlauf der Weltgeschichte beeinflusst. Zweimal hinderten Taifune den mongolischen Grossherrscher Kublai Khan an der Eroberung Japans. Der Untergang der mächtigen spanischen Armada während der entscheidenden Seeschlacht wurde durch wiederholte Stürme besiegelt. «Ich habe meine Armada zum Kampf gegen die Engländer ausgesandt, nicht gegen Naturgewalten», beklagte sich Philip II. von Spanien daraufhin bitterlich.
Am Vorabend der Französischen Revolution liess zunächst eine Frühlingsdürre die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen, dann vernichtete ein verheerender Hagelsturm die Getreidefelder. Im Juli 1789 wurden die höchsten Brotpreise des Jahrhunderts bezahlt: Die Not des Volkes war nun so gross, dass es reif für die Revolution war.
Auch die europäischen Auswanderungswellen im 18. und 19. Jahrhundert hatten mit dem Wetter zu tun. Neben politischen und religiösen Gründen waren es immer wieder Missernten und darauf folgende Hungersnöte, die die Menschen zur Auswanderung zwangen. Von 1769 bis 1771 gab es in Deutschland «drei Jahre fast nur Regen» – die Menschen wandern in Massen nach Ungarn und Amerika aus.
Das Jahr 1816 ging in Europa als «Jahr ohne Sommer» in die Geschichtsbücher ein. Von April bis September fielen Regen-, Graupel- und Schneeschauer, im Juni und Juli herrschten winterliche Temperaturen. (Ursache für diese Klimakatastrophe war übrigens der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora ein Jahr zuvor). Es gab keine Ernte – Tausende wandten sich nach Galizien und Nordamerika, in der Hoffnung, dem Hunger und der Armut zu entgehen.
Frost Ende Mai vernichtete im Jahre 1867 die Ernte im Wallis. Anfang 1868 schrieb das «Walliser Wochenblatt»: «Seit vielen Jahren herrschte hier im Lande kein so grosser Mangel an Korn und waren die Brotpreise so drückend.» Diese Notlage veranlasste 360 Oberwalliser, in Argentinien eine neue Heimat zu suchen.
Unvergessen bleibt mir das Märchen vom Bauern, der mit Erlaubnis des lieben Gottes ein Jahr lang das Wetter machen durfte. Er liess die Sonne scheinen, es in der richtigen Menge regnen, liess Hagel und Unwetter sich in unbewohnten Gegenden austoben, kurz, er machte perfektes Wetter.
Die Ernte missriet trotzdem – unser tüchtiges Bäuerlein hatte den Wind vergessen, der das Korn bestäuben muss, damit es Frucht trägt.
Wie schon gesagt, das Wetter entzieht sich noch immer weitgehend der Manipulation durch den Menschen. Wir können Wind und Regen, Sonnenschein und Sturm nicht grundlegend beeinflussen.
Das liegt aber nicht daran, dass wir es nicht versuchten. Insbesondere das Militär zeigte grosses Interesse an Projekten zur Wettermanipulation. Als man entdeckte, dass man Wolken mit der Chemikalie Silberjodid zum schnellen Abregnen bringen kann, planten amerikanische Militäringenieure ein Wolkenbombardement mit riesigen Granaten, geladen mit Silberjodid und Trockeneiskörnchen. Die Sowjetunion sollte so mit einer Dürre bedroht werden. Diese Kontrolle des Wetters könne «eine subtile neue Waffe werden, welche die Agrarproduktion beeinträchtigt, die Wirtschaft schädigt und die Industrie lahmlegt», schrieb 1961 der US-Admiral Luis de Florez.
Ziviler wird die Technik beim «Hagelflieger» eingesetzt, um die Landwirtschaft zu schützen. Per Flugzeug «impft» man die Wolken mit dem gelben Silberjodid-Salz, wodurch sie ausregnen, bevor sich grosse Hagelkörner bilden. In etwa 30 Ländern der Erde wird diese Wetterkontrolle betrieben. In den USA z.B. liefern eine ganze Reihe privater Unternehmen per Flugzeugimpfung «Regen auf Bestellung».
Weltmeister der Wettermacher ist China. Sein «Wetter-Modifikationsprogramm» mit 32000 Mitarbeitern nutzt neben Flugzeugen Raketenwerfer und Flugabwehrkanonen, um Wolken mit Silberjodid zu beschiessen. So sollen seit 2000 pro Jahr 250 Milliarden Tonnen Regenwasser künstlich erzeugt worden sein. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 möchten die Planer ebenfalls die Salzkanonen einsetzen: Sie sollen wolkenlosen Himmel über Peking garantieren. Langsam aber regt sich Kritik an der staatlichen Wetterkontrolle.
Dass die Aktivitäten des Menschen langfristig Auswirkungen auf das Klima haben, wird immer deutlicher sichtbar. Aber auch das Wetter einer Woche wird inzwischen vom Menschen beeinflusst. «Am Montag scheint die Sonne öfter als am Wochenende, aber am wärmsten ist es mittwochs.»
Zu dieser verblüffenden Erkenntnis kamen Wissenschaftler des Forschungszentrums Karlsruhe. Sie stellten nämlich fest, dass der Maximalwert der täglichen Sonnenscheindauer regelmässig am Wochenanfang liegt – die Sonne scheint durchschnittlich 15 Minuten länger als am Samstag, der die kürzeste Sonnenscheindauer hat. Im Laufe der Woche nehmen die Niederschläge zu und die Lufttemperatur wird höher, wobei die Höchstwerte mittwochs auftreten und im Mittel um mehr als 0,2 Grad über den samstäglichen Tiefstwerten liegen.
Das sind nicht etwa örtliche Erscheinungen, die z.B. durch lokale Wärmeemissionen oder regionale Unterschiede erklärt werden könnten. Die Schlussfolgerungen beruhen auf 15 Jahre langen Messreihen von 12 sehr unterschiedlich gelegenen Stationen des Deutschen Wetterdienstes, immerhin 6,3 Millionen Messwerte. Das Phänomen tritt auch nicht nur an Stationen in dicht besiedelten Regionen auf, sondern auch an entlegenen Bergstationen wie auf der Zugspitze.
Einer solchen Periodizität von genau einer Woche kann kein natürlicher Prozess zugrunde liegen, nur die einem Wochenzyklus unterliegenden Aktivitäten des Menschen kommen als Ursache in Frage.
Den Auslöser fanden die Forscher in den Aerosolen, feinsten Partikelchen in der Luft. Diese streuen und absorbieren Sonnenlicht, greifen aber auch als Kondensationskeime in die Wolken- und Niederschlagsbildung ein. Vom Menschen er-zeugte Aerosole, zum Beispiel Russ- oder Sulfatpartikel, werden an Wochentagen von Verkehr und Industrie verstärkt abgegeben, während die Emissionen samstags und insbesondere sonntags deutlich zurückgehen.
Und dann scheint montags die Sonne wieder länger.

