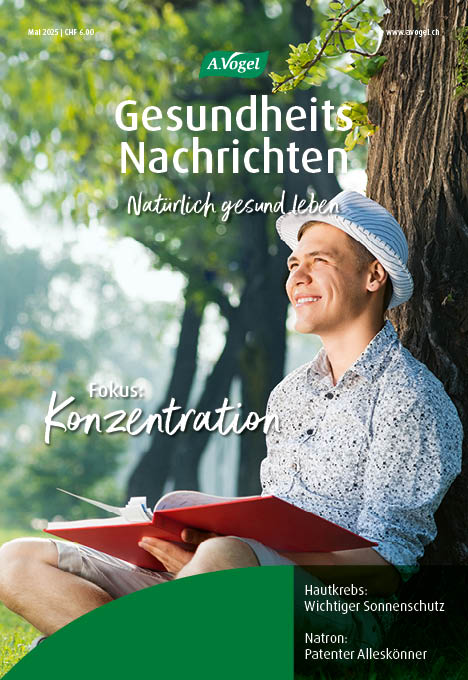A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.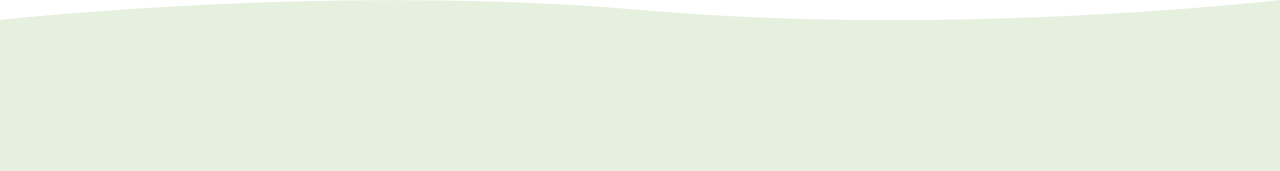
Nein sagen: Die Kunst der Abgrenzung
Niemand kann alle Erwartungen der anderen erfüllen. Aber ein Nein kostet Kraft und kann Angst und Schuldgefühle auslösen. Dabei ist Abgrenzung wichtig: für die eigene Person und das Gegenüber.
Autorin: Gisela Dürselen
«Könntest du mal …?» Damit beginnt eine typische Frage, die viele Menschen in Bedrängnis bringt. Einerseits trauen sie sich nicht abzulehnen, weil sie Probleme mit Chef, Partner oder Kindern befürchten und keinesfalls die Harmonie wegen eines möglichen Konflikts riskieren wollen. Andererseits ist das Resultat oft ein lauwarmes Ja, das eigentlich ein Nein bedeutet: Wer widerwillig Ja sagt, verschiebt oder vergisst vielleicht das Versprochene, findet eine Ausrede oder erfüllt das Zugesagte nur halbherzig.
Aus psychologischer Sicht erwächst die Stärke, sich abzugrenzen, aus dem Bewusstsein vom eigenen Selbstwert. Je mehr ein Mensch sich selbst zutraut, desto weniger abhängig ist er vom Urteil anderer.
Die Paar- und Familientherapeutin Ulrike Dahm geht davon aus, dass die grundsätzliche Schwierigkeit, Nein zu sagen, in der Angst vor Ablehnung liegt. Die Ursachen dafür können nach psychologischen Erkenntnissen bis in die Kindheit zurückgehen: Kinder unternehmen alles, um Liebe und Anerkennung ihrer Bezugspersonen zu gewinnen. Wenn die Botschaft der Erwachsenen lautet: «Mach es allen recht», beeinflusst dies das Verhalten der Kinder und kann als prägendes Muster bis ins Erwachsenenalter nachwirken.
Zwei Pole im Kontakt mit den anderen gehören Ulrike Dahm zufolge zu den menschlichen Grundbedürfnissen: der Wunsch nach Nähe und Geborgenheit, nach Liebe, Hingabe und Sicherheit – und genauso das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit, Abgrenzung und Individualität.
Es gehe darum, die Balance zu finden zwischen bedingungsloser Zustimmung und Selbstaufgabe auf der einen Seite – und trotziger Abwehr auf der anderen. Wichtig sei, die Spannung auszuhalten, die ein Nein mit sich bringt, und die innere Freiheit zu finden, sich je nach Situation neu zu entscheiden. Ein stimmiges Nein zur richtigen Zeit bedeutet laut Ulrike Dahm die Übernahme von Verantwortung fürs eigene Handeln. Der Gewinn ist das Erleben der persönlichen Mitte: Ein Wohlbefinden, über das jeder für sich selbst entscheidet, unabhängig von der Zustimmung anderer.

«Liebe deinen Nächsten» steht schon in der Bibel. Aber es heisst dort auch: «... wie dich selbst». Aus christlicher Sicht sind die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu sich selbst ein Paar. Dennoch liegt manchmal nur ein schmaler Grat zwischen Selbstverwirklichung um jeden Preis und Selbstliebe im positiven Sinne. Für William Ury, Mediator und Mitautor des berühmten «Harvard-Konzepts» für Kommunikation, liegt der Unterschied zwischen einem destruktiven und einem konstruktiven Nein in der inneren Haltung: Ein positives Nein beinhalte ein generelles Ja – sowohl zu sich selbst als auch zum Mitmenschen.
Ury sieht den Schlüssel für gelingendes Miteinander in der gegenseitigen Wertschätzung. Ein Nein, das erklärt wird und dem Gegenüber Respekt zollt, könne leichter angenommen werden, weil sich die andere Person nicht zurückgewiesen fühlt. Aus dieser Art von Fairness heraus entsteht laut Ury die konstruktive Auseinandersetzung, die eine Beziehung stärkt, nicht zerstört.
Dass die Kunst des Neinsagens zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise eine persönliche Stärke ist, unterstreichen auch der Benediktinerpater Anselm Grün und die Sozialpädagogin Ramona Robben in ihrem Buch «Grenzen setzen – Grenzen achten»: Gelegentliches Neinsagen sei sogar Voraussetzung für eine gelingende Beziehung.
Denn eine solche erfordert beides: Nähe und Distanz, Sich-Hingeben und Sich-Abgrenzen. Wer nicht in seiner Mitte ist, kann sich schlecht gegen Grenzüberschreitungen anderer schützen und auf Dauer krank werden – psychisch und körperlich.
Manchmal gehen Anforderungen von aussen und innere Antreiber Hand in Hand. Der Anspruch, möglichst perfekt zu sein und viel zu leisten, tritt insbesondere im Beruf zutage. Wer sich aber fortwährend an der Grenze seiner Belastbarkeit bewegt und immer wieder die eigenen Grenzen überschreitet, kann nicht mehr auftanken und muss früher oder später dafür bezahlen: mit verminderter Lebensqualität, mit sinkender Leistungsfähigkeit und Kreativität, mit gescheiterten Beziehungen und manchmal auch mit Krankheit und dramatischen Lebenskrisen.
Diese Dynamik beschreibt ein Team des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) München, das den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Gesundheit in der IT-Branche untersucht. Anlass für das bis Mai 2010 laufende Projekt waren eine Häufung von Burnout, Depression, Tinnitus, Suchtverhalten und Panikattacken in besonders stressreichen Branchen.
Was das Münchner Forscherteam wissenschaftlich untersucht, hat der Vizepräsident des Verbandes deutscher Betriebs- und Werksärzte, Dr. Detlef Glomm, schon hundertfach praktisch erlebt: mit Patienten, die dem Arbeitsdruck nicht mehr gewachsen sind und dies erst zu spät erkennen. Der Arbeitsmediziner rät daher, rechtzeitig und konsequent Nein zu sagen und sich auch einmal klar und deutlich selbst einzugestehen und nach aussen zu signalisieren: «Das schaffe ich nicht». Es sei in Ordnung, sich abzugrenzen und nicht rund um die Uhr für alles und jeden erreichbar zu sein.
Schlecht Nein sagen zu können betrifft Männer vor allem bei der Arbeit – für Frauen ist es ein grundlegendes Thema. Davon ist die Therapeutin Ulrike Dahm überzeugt. In ihrem Buch «Starke Frauen sagen Nein» beschreibt sie, warum mangelnde Abgrenzung typisch weiblich ist – und wie Frauen lernen können, besser auf sich selbst zu achten.

Gisela Dürselen sprach für A.Vogel mit der Therapeutin und Autorin Ulrike Dahm.
A.Vogel (AV): Frau Dahm, warum fällt es besonders Frauen schwer, sich abzugrenzen und Nein zu sagen?
Ulrike Dahm: Frauen sind viel mehr auf das Du ausgerichtet als Männer – und damit häufig abhängiger von der Anerkennung anderer. Biologisch sind sie für die Aufzucht der «Brut» verantwortlich, und das bedeutet nun mal, immer wieder die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen.
Darüber hinaus sind vor allem ältere Frauen noch darauf konditioniert, in erster Linie lieb und nett zu sein. Meine eigene Mutter sagte mir immer wieder voraus, ich würde keinen Mann finden, wenn ich so kompliziert und unnachgiebig sei. Eine Frau müsse dem Mann die Illusion lassen, er sei der Bestimmende, Starke. Frauen sollten nach ihrer Vorstellung auf keinen Fall ihre Stärke offen zeigen.
Häufig fühlen sich Frauen immer noch nicht vollständig, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite haben. Sie tun viel dafür, den Männern zu gefallen. Kaum ein Mann macht sich Gedanken, wenn er ein Bäuchlein hat. Frauen dagegen haben einen starken inneren Kritiker, der von den Medien noch angeheizt wird. Und wenn ich als Frau nicht dem perfekten Schönheitsideal entspreche, muss ich diesen Makel wenigstens damit ausgleichen, dass ich mich nach den Wünschen der Männer richte und eigene Bedürfnisse hintenanstelle.
AV: Sie sagen, dass sich die klassischen Geschlechterrollen nicht so sehr verändert haben. Nach wie vor gibt es die Rolle als hingebungsvolle Ehefrau und aufopfernde Mutter; dazu kommen nun die Anforderungen im Beruf. Wie sähe Ihrer Meinung nach die neue Frau aus, die auch auf ihre eigenen Bedürfnisse hört?
Ulrike Dahm: Ich stimme da ganz und gar der Best-sellerautorin Eva-Maria Zurhorst zu, die sagt, wir bräuchten eine sanfte Frauenrevolution. Die Emanzipationsbewegung war wichtig und hat uns Frauen die Gleichberechtigung, zumindest auf dem Papier, beschert. Doch viele Frauen haben damals gegen die Männer gekämpft und versucht, die besseren Männer zu sein. Frauen haben aber ganz andere Stärken als Männer. Ihre Kraft ist sanft und weich, sie sind mehr mit ihren Gefühlen verbunden, verfügen über emotionale Intelligenz. Sie kümmern sich um ihre Mitmenschen, und es lässt sie nicht kalt, welche Folgen ihr Handeln hat.
Frauen müssen häufig erst mal wieder lernen, ihre Bedürfnisse zu spüren. Am besten gelingt ihnen das, wenn sie wieder mehr mit ihrem Körper verbunden sind, sich nicht ständig mit anderen Frauen vergleichen und sich nach gängigen Schönheitsidealen richten. Jede Frau ist schön, wenn sie mit ihrer weiblichen Kraft verbunden ist, mit Würde und aufrecht durchs Leben geht, egal, ob sie 50 oder 80 Kilo wiegt.
Kraftvoll und aufrecht durchs Leben zu gehen, heisst aber nicht, zur Trotztochter zu werden und das Nein zu kultivieren. Es geht immer um Wahlmöglichkeiten: Will ich in einer bestimmten Situation Ja oder Nein sagen? Viele Frauen haben diese Wahlmöglichkeit nicht.
AV: Besonders Eltern tun sich manchmal schwer, eigenen Freiraum zu beanspruchen, ohne sich gleichzeitig egoistisch zu fühlen. Was raten Sie überforderten Müttern?

Ulrike Dahm: Der Balanceakt zwischen persönlichem Freiraum und Familie ist nicht immer leicht. Und es gibt Zeiten, besonders wenn die Kinder noch klein sind, da ist die Zeit, die eine Frau für sich selbst hat, knapp.
Ich sage Frauen, die zu mir in die Therapie oder zu Seminaren kommen, immer wieder: Ihr habt sensible Antennen dafür entwickelt, was andere Menschen brauchen. Aber die Antennen, die nach innen gehen, wo ihr spürt, was ihr selbst braucht, sind verkümmert. Es ist wichtig, dass ihr nicht nur für eure Familie, sondern auch euch selbst eine gute Mutter seid. Es gibt immer kleine Inseln, die ich mir im Tagesablauf schaffen kann, um wieder bei mir selbst anzudocken. Und manchmal bedeutet das den Verzicht auf meine perfektionistischen Ansprüche.
AV: Rechtzeitig die eigenen Grenzen ziehen, bevor es zur Überforderung kommt, ist eine soziale Kompetenz und kann als solche erlernt werden. Was könnte Ihrer Meinung nach der erste Schritt sein?
Ulrike Dahm: Der erste Schritt muss sein, die eigenen Grenzen überhaupt zu spüren. In meiner Arbeit wird immer wieder deutlich, dass Frauen ihre Grenzen erst dann wahrnehmen, wenn sie deutlich überschritten werden. Grenzen spürt man körperlich. In einem zweiten Schritt kann man üben, Grenzen klar und deutlich zu formulieren.