A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.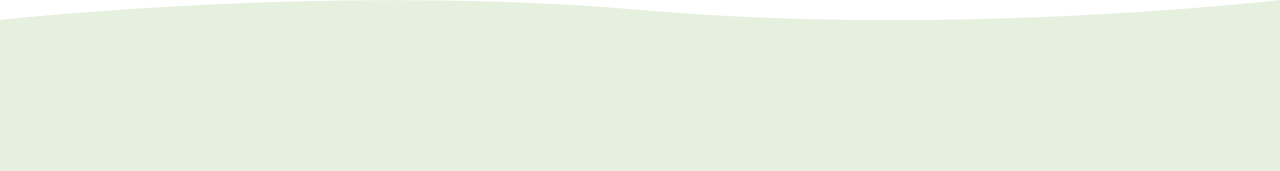
Bin ich Hypochonder?
Hypochondrie: Die ständige Angst ernsthaft Krank zu sein.
War dieser Leberleck schon immer so unregelmässig? Wurde das bei der letzten Kontrolle übersehen? Der nächste Termin bei der Hautärztin ist erst in Monaten! Diese und andere Fragen beschäftigen Hypochonder unentwegt, bestimmen ihre Tagesabläufe und verhindern eine normale Körperwahrnehmung. Doch es gibt zum Glück Hilfe.
Text und Interview: Tino Richter, 05.18
Hypochondrie (Hypochondrische Störung oder Krankheitsangststörung) wird häufig immer noch mit wehleidigen oder neurotischen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um eine ernsthafte Erkrankung, in deren Zentrum die übermässige Beschäftigung mit der Angst oder der Überzeugung, eine ernsthafte Krankheit zu haben, steht. Für die Komödie taugt der sprichwörtliche «Eingebildete Kranke» (Molière) jedoch nicht, denn diese Angst bleibt auch nach einer angemessenen medizinischen Abklärung bestehen und lässt sich nur kurzfristig lindern. Der Grund für die Angst ist eine Fehlinterpretation körperlicher Symptome durch die betroffene Person, sie kann aber auch losgelöst von konkreten Beschwerden entstehen. Betroffen sind etwa ein Prozent der Bevölkerung, Männer und Frauen aus allen sozialen Schichten gleichermassen.
Das Problem der Hypochondrischen Störung ist, dass Allgemeinmediziner oft lange nicht bemerken, was mit ihren Patienten wirklich los ist. Studien zeigen, dass nicht einmal die Hälfte der Fälle mit psychischen Störungen erkannt wird. Doch statt den Betroffenen an einen Therapeuten zu verweisen, werden oft weitere Untersuchungen angestellt, die keinen Sinn ergeben – nur um den Patienten ruhigzustellen. Die ständige Rückversicherung hat Suchtcharakter, der durchschnittliche «Hypochonder» trifft so erst nach sechs bis zehn Jahren auf eine Therapeutin, die ihn von der Sucht nach Ärzten befreit. Leider liegt der Schwerpunkt der Ärzteausbildung immer noch auf den rein körperlichen Beschwerden. Denn auch wenn Symptome wahrnehmbar sind, kann es sein, dass, wie im Falle der Somatisierungsstörung, der Arzt keine organische Ursache feststellen kann. Mediziner sollten daher kritischer sein, ihre Patienten aber ernst nehmen und vor allem zugeben, wenn sie nicht weiterwissen. Oft ist es die Familie, welche miterleben muss, wie die Angst vor einer Krankheit einen Menschen immer mehr beherrscht. Angehörige sollten deshalb möglichst nicht auf die beklagten oder vermeintlichen Krankheiten eingehen, sondern darauf, wie sich die geliebte Person verändert.

Die Standardbehandlung bei einer Hypochondrischen Störung ist die Kognitive Verhaltenstherapie. Dabei wird versucht, an der Wahrnehmung der Patienten zu arbeiten, z.B. indem diese festhalten müssen, was bei den wahrgenommenen Symptomen für und was gegen eine ernsthafte Erkrankung spricht. Oder wie man selbst von der Krankheit proitiert, z.B. durch mehr Aufmerksamkeit. Weiterhin wird beleuchtet, wie die Krankheit den Betroffenen davon abhält, Freude zu empinden oder sich einer Verantwortung zu stellen. Wird die Krankheit gar als «gerechte» Bestrafung für ein vermeintliches Missverhalten empfunden? Diese ersten Therapieschritte zielen darauf ab, die Krankheitsüberzeugung zu relativieren. Die Erfolgsaussichten sind relativ gut: Etwa drei Viertel aller Patienten kann geholfen werden, so Dr. Gaby Bleichhardt vom Psychologischen Institut der Universität Marburg (s. Interview rechts). Wie gross der Einluss von Krankheitsängsten auf die Lebenserwartung ist, lässt sich anhand von Studien nicht eindeutig sagen. Einerseits können Hypochonder besonders lange leben, da sie medizinisch «überversorgt » sind, andererseits zehrt der permanente Stress auch an den Kräften.
Dr. Gaby Bleichhardt ist Psychologische Psychotherapeutin und lehrt seit zehn Jahren am Psychologischen Institut der Universität Marburg.
Gesundheits-Nachrichten (GN): Welche Faktoren können eine Hypochondrische Störung begünstigen?
Dr. Gaby Bleichhardt (GB): Wichtig zu wissen ist, dass es immer ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren ist, die Hypochondrie entstehen lassen. Die Faktoren sind nicht zu verstehen als hinreichende Ursachen – es gibt Menschen, die alle diese Dinge haben, aber zum Glück trotzdem keine Hypochondrie entwickeln.
GN: Welche Faktoren sind das?
GB: Eine schon lange bestehende Ängstlichkeit der Betroffenen. Nicht selten entsteht diese aus einem ängstlichen Verhalten der Eltern. Wenn die Eltern zudem selbst krankheitsängstlich sind oder auch dem Kranksein ihrer Kinder aussergewöhnlich viel Beachtung schenken, fördert dies die spätere Entwicklung einer Hypochondrie. Andererseits war bei Patienten mit Erfahrungen von Vernachlässigung in der Kindheit eine Krankheit oft auch die einzige Möglichkeit, positive Zuwendung zu erhalten. Viele Betroffene haben besondere negative Erfahrungen mit Krankheiten gemacht. Ein paar meiner Patienten bekamen irrtümlich eine sehr schwere Diagnose mitgeteilt, und erst Wochen bzw. Monate später erfuhren sie, dass sie eigentlich gesund sind.
GN: Was passiert bei den Betroffenen?
GB: Es wird gemeinhin davon ausgegangen, dass Faktoren wie oben erwähnt zu zwei psychologischen Mechanismen führen, die sich gegenseitig in einem Teufelskreis antreiben: Zum einen besteht eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den Körper und seine Vorgänge – und dadurch werden natürlich auch zunehmend vermeintliche Auffälligkeiten entdeckt. Zum anderen tendieren die Personen dazu, körperliche Empindungen eher katastrophisierend statt neutral zu interpretieren. Dieser Teufelskreis nennt sich somatosensorische Verstärkung.
GN: Und daraus entsteht die sprichwörtliche «eingebildete
Krankheit»?
GB: Der meines Erachtens sehr entscheidende Faktor ist, wie Menschen mit ihrer Krankheitsangst umgehen. Wer bei starker Angst so schnell wie möglich eine ärztliche Abklärung vornehmen lässt, erfährt durch die Beruhigung des Mediziners eine immense Entlastung, wir nennen dies «negative Verstärkung». Dieses Gefühl wird dazu führen, bei der nächsten Beunruhigung wieder schnellstmöglich ärztliche Rückversicherung zu suchen. Je häuiger dies passiert, desto weniger sind die Betroffenen in der Lage, Krankheitsängste auszuhalten oder eigenständige Beurteilungen ihrer Missempindungen vorzunehmen.
GN: Treten Krankheitsängste bei beiden Geschlechtern bzw. in allen Kulturen gleich häuig auf?
GB: Es gibt eine grosse weltweite Studie, die leider schon 20 Jahre alt ist. Interessanterweise unterscheiden sich die Prävalenzraten, also die Häuigkeit, mit der die Krankheit auftritt, in diesen Ländern kaum voneinander. Die weltweite Häuigkeit wurde dort auf 0,8 Prozent bestimmt. Mit den Geschlechtern verhält es sich ähnlich: Männer und Frauen scheinen gleich häuig betroffen zu sein. Das ist spannend, denn das Kernsymptom der Hypochondrie ist ja eine Angst. Angststörungen treten aber bei Frauen deutlich häuiger auf.
GN: Offenbar kann Hypochondrie jederzeit auftreten. Welche Strategien gibt es, das zu vermeiden?
GB: Das ist eine gute Frage! Ganz allgemein würde ich zunächst antworten: Mutig sein und sich auf den Rest des Lebens fokussieren. Fast jeder Mensch hat im Leben mal eine Phase, in der er eine Krankheitsbefürchtung entwickelt. Wenn die körperlichen Empindungen, die dieser Idee zugrunde liegen, nicht nach ein paar Tagen bzw. Wochen verschwinden, ist es sehr vernünftig, zum Arzt zu gehen. Tritt die Angst aber einige Zeit nach adäquater medizinischer Rückversicherung wieder auf, sollten die Personen versuchen, die Krankheitsangst auszuhalten und alternative Erklärungen zu erwägen. Dabei hilft es natürlich, wenn man ein abwechslungsreiches und befriedigendes Leben führt. Nicht jeder Mensch lebt in Bedingungen, in denen dies leicht gelingt. Aber jeder sollte meines Erachtens danach streben.
GN: Gibt es Erkenntnisse darüber, ob die Häuigkeit dieser psychischen Störung in den letzten Jahren zu- oder abgenommen hat?
GB: Leider gibt es viel zu wenige Untersuchungen zur Häuigkeit von Krankheitsängsten, und gar keine zu deren Entwicklungen für die letzten Jahre. Es kann zumindest nicht angenommen werden, dass Krankheitsängste abnehmen. Dabei spielen meiner Meinung nach die Medien eine grosse Rolle. Deren Einschalt- bzw. Nutzungsquoten steigen, je stärker mit emotionen gespielt wird. Dies sieht man z.B. in der Berichterstattung zur Schweinegrippe oder zur Feinstoffbelastung von Dieselmotoren. Aber auch eine zunehmende Aufklärung über die Grenzen der Medizin, welche prinzipiell sehr zu begrüssen ist, verunsichert bestimmte Menschen. Dass ein Arzt zugibt, nicht zu wissen, warum eine körperliche Missempfindung da ist, dürfte im letzten Jahrhundert nur vereinzelt vorgekommen sein.
GN: Früher war medizinisches Wissen den Ärzten vorbehalten. Wie hat sich die breitere Verfügbarkeit dieser Wissensbestände auf Hypochondrische Störungen ausgewirkt?
GB: Wenn Sie mich als Wissenschaftlerin fragen, muss ich leider antworten: Wir wissen es nicht. Es ist aber leider auch unmöglich, die isolierte Wirkung der Wissensverfügbarkeit auf die Häuigkeit der Krankheitsangst zu messen. Mein Eindruck als Psychotherapeutin ist, dass Menschen zunehmend verunsichert sind. Das gilt für Krankheitsangst genauso wie für vieles andere. Früher gab es für vieles einfache Antworten, auch wenn sie nicht selten falsch waren. Heutzutage ist eine grössere Unsicherheitstoleranz notwendig, um funktionsfähig zu bleiben, also sich beispielsweise nicht von seinen Krankheitsängsten bestimmen zu lassen.
GN: Welche Rolle spielt hierbei das Internet?
GB: Das Internet bietet die Möglichkeit, sehr einfach an Informationen zu Krankheiten zu kommen. Allerdings sind diese selten hilfreich. Gibt z.B. jemand die beiden Missempindungen, unter denen er derzeit leidet, in eine Suchmaschine ein, wird er wohl kaum auf die Antwort «Eine Kombination dieser Symptome deutet auf keine ernste Erkrankung hin» inden. Am kritischsten sind Chatforen zu betrachten, in denen im Gegensatz zu Gesundheitsinformationsdiensten der Wahrheitsgrad von Informationen völlig ungeprüft bleibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass man das Internet für die Entwicklung von Hypochondrie verantwortlich machen sollte. Exzessive Internetrecherche zu Krankheitsinformationen verunsichert die Betroffenen zunehmend, sie ist aber nicht die Ursache.
GN: Gibt es neben einer psychotherapeutischen Betreuung Verhaltenstipps für Angehörige?
GB: Ich würde es kurz als «freundlich und verständnisvoll bleiben, aber mit Verstand» bezeichnen. Zum einen sollten die Angehörigen versuchen zu verstehen, dass Hypochondrie ein ernst zu nehmendes psychisches Problem ist, und die Betroffenen mitunter unter erheblichen und prinzipiell nachvollziehbaren Ängsten leiden können, bald zu versterben. Zum anderen wird man als Angehöriger aber häuig in das Rückversicherungssystem eingespannt, z.B. mit Fragen wie «Denkst du nicht, ich sollte nochmal zu Dr. Müller gehen?». Intuitiv würde man den Betroffenen mit Sätzen wie «Mach dir keine Sorgen. Du hast nichts Schlimmes» beruhigen wollen. Besser wäre, man könnte diesem Impuls widerstehen, sich einer Antwort entziehen und den Betroffenen auf seine eigenen Entscheidungsfähigkeiten, auch die zur Aufnahme einer Psychotherapie, hinweisen.
GN: Wie stehen die Heilungschancen?
GB: Die Erfolgsraten für die Hypochondrie sind nach einer Kognitiven Verhaltenstherapie gemeinhin sehr gut. Wenn die Patienten engagiert in einer solchen Therapie mitarbeiten, reduzieren sich in den allermeisten Fällen die Krankheitsängste beträchtlich.


