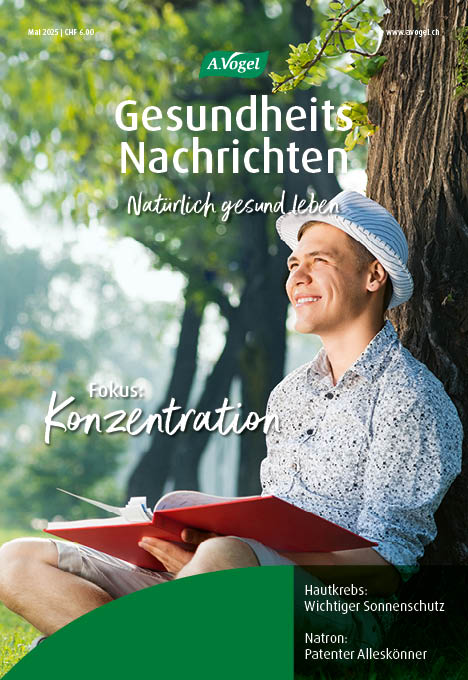A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.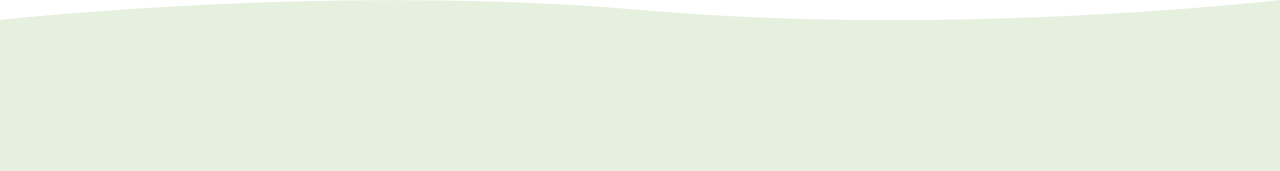
Cannabis: Rauschmittel und Heilpflanze
Die Verwendung von Cannabis in der Medizin steht in der öffentlichen Diskussion. Arzneien auf Hanf-Basis können vor allem Schwerkranken helfen. Aber nur wenige Patienten profitieren bislang davon, denn die Hürden für die Beschaffung sind hoch.
Autorin: Gisela Dürselen, 05.15
- Letzte Option Cannabis
- Cannabis-Öl entwickelt
- Cannabis: Medikament versus Rauschmittel
- Cannabis-Therapie kann teuer werden
- Alternativen und staatliche Kontrollen
- Cannabis als Medikament: Medizinisches Potenzial
- Blick in die Zukunft
- Körpereigene Cannabinoide
- Die ganze Hanf-Pflanze erforschen
- Hanf mit exzellenter Öko-Bilanz
Bea Goldman ist Pflegefachfrau am St. Galler Kantonsspital, und als solche hat sie schon viele schwerkranke Patienten für die Cannabinoidbehandlung instruiert und betreut. Dies betrifft vor allem Menschen mit ALS, einer unheilbaren Nervenerkrankung mit verkürzter Lebenserwartung, die oft mit schwer therapierbaren Spastiken oder Muskelkrämpfen einhergeht. Oft war die Rezeptur aus der Cannabis-Pflanze das Einzige, was wirklich half.
Bea Goldman weiss, dass die Beschaffung von Cannabis eine Gratwanderung sein kann: zum Beispiel dann, wenn Kranke im Endstadium sich in ihrer Verzweiflung am Schwarzmarkt Cannabis besorgen und irgendetwas daraus herstellen. Unter Umständen machen sie sich strafbar und riskieren auch noch, Ware von zweifelhafter Qualität zu bekommen, die zu hohe Konzentrationen an berauschendem Tetrahydrocannabinol (THC) enthält oder mit unbekannten Beimischungen, Pilzsporen oder Bakterien verunreinigt ist.
Um solchen Menschen zu helfen, hat Bea Goldman ein Cannabis-Öl entwickelt, das seit November 2014 vom Arzneimittelhersteller Hänseler in Herisau produziert wird. Darüber hinaus gibt es schon seit einiger Zeit fachlichen Rat am St. Galler Kantonsspital. Dort wird nun die schweizweit erste Cannabinoid-Beratung offiziell beantragt.
Das Problem an Cannabis ist, dass es nicht nur Medizin, sondern auch verbotenes Rauschmittel ist. 2008 haben sich die Schweizer im Zuge einer Revision des Betäubungsmittelgesetzes gegen eine generelle Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Damit blieb auch der Anbau von Hanfpflanzen verboten, die ein oder mehr Prozent des Wirkstoffs THC beinhalten. Erlaubt sind seitdem jedoch medizinische Präparate mit THC. Vom Arzt verordnet werden das Mundspray Sativex, das vor allem Patienten mit multipler Sklerose helfen kann, und der THC-haltige Wirkstoff Dronabinol, der synthetisch aus einem Bestandteil von Zitronenschalen gewonnen wird.
Wer sich eine dieser Arzneien verschreiben lassen will, braucht allerdings Geduld und Geld: Nicht alle Ärzte wissen genug über Anwendung und Dosierung, und manche scheuen den Aufwand. Auch sind die Krankenkassen zur Kostenübernahme nicht verpflichtet. Oft können sich Patienten eine Therapie nicht leisten, weil diese im Monat mehrere Hundert Franken verschlingen kann.
Initiativen in mehreren europäischen Ländern fordern legale Verschreibungsmodelle und Kostenübernahme durch die Kassen. Denn Medikamente auf Cannabisbasis sind mittlerweile zwar vielerorts erlaubt – aber meist kein medizinisches Cannabis: also die Pflanze selbst oder Teile davon wie etwa die stark THC-haltigen Cannabisblüten. Solche aber wären viel preiswerter zu haben als die legalen synthetischen Cannabis-Arzneien, die oft exorbitant teuer sind.
Wie in der Schweiz zahlen auch in anderen Ländern die Krankenkassen nur in Ausnahmefällen: In Deutschland beispielsweise, wo der erste Cannabisextrakt 2011 zugelassen wurde, erstatten nur einige Kassen bei schweren Formen von Spastik, etwa in Folge von multipler Sklerose. Mittlerweile kommt jedoch Bewegung in die Diskussion: Am 22. Juli 2014 erlaubte das Kölner Verwaltungsgericht drei chronisch Kranken, ihr Cannabis selbst anzubauen. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, weil eine Berufung vorliegt. Doch die deutsche Bundesregierung wird nun ihrerseits aktiv und will noch 2015 einen Gesetzesentwurf erörtern, nach dem in medizinisch begründeten Fällen die Verschreibung von Cannabis eine Kassenleistung werden soll.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Die jetzige Situation ist unbefriedigend, weil legale Medikation mit Cannabis oft unerschwinglich ist und andere Wege zu viele Unsicherheiten bergen. Doch wie können kontrollierte Qualität und die richtige Dosierung gewährleistet werden? Und wie minimalisiert man unerwünschte Nebenwirkungen? Als Antwort darauf haben Züchter inzwischen spezielle Sorten entwickelt, die einen hohen Anteil an Cannabidiol (CBD) enthalten: Cannabidiol ist neben THC ein zweiter Hauptwirkstoff der Pflanze, der unter anderem in der Lage ist, die berauschenden Wirkungen des THC zu dämpfen. Um die schädlichen Nebeneffekte des Rauchens auszuschliessen und eine genauere Dosierung zu ermöglichen, wurden mit Mundspray und Verdampfer alternative Verabreichungsformen gefunden.
Einen besonderen Weg der Qualitätskontrolle verfolgt Holland: Bereits 2003 wurde dort eine Behörde für medizinisches Cannabis eingerichtet; am niederländischen Gesundheitsministerium gibt es eine eigene Beratungsstelle, und das Unternehmen «Bedrocan» produziert Cannabis-Pflanzen zum medizinischen Gebrauch im biologischen Anbau, vom Staat beauftragt und von diesem kontrolliert.
Aktuell wird die Diskussion um Cannabis als Medikament vor allem deshalb geführt, weil es immer mehr Hinweise dafür gibt, dass die Pflanze über ihre berauschende Wirkung hinaus grosses medizinisches Potenzial besitzt. Über 600 verschiedene Wirkstoffe sind bekannt, darunter über 60 Cannabinoide, die vor allem schmerzlindernd und krampflösend wirken. Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena fanden heraus, dass vor allem das nicht psychoaktive Cannabidiol (CBD), aber auch das berauschend wirkende Tetrahydrocannabinol (THC) sowie sechs weitere Cannabinoide für die Wirkung verantwortlich sind. Sie wirken auf doppelte Weise entzündungshemmend, indem sie die Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoffe bremsen und gleichzeitig die Synthese von immunregulatorischen Enzymen anregen – im Gegensatz zu gängigen Schmerzmitteln wie Aspirin, Ibuprofen oder Paracetamol. Am stärksten ist der positive Effekt bei CBD, das schon in geringen Dosen entzündungshemmend wirkt. Dies eröffnet Cannabis ein breites Einsatzspektrum, etwa bei entzündlichen Darmerkrankungen, Hautleiden oder sogar Alzheimer und anderen mit Entzündungsreaktionen im Gehirn verbundenen, neurologischen Krankheiten. Die Substanz Cannabidiol kann die therapeutischen Effekte des THC unterstützen und wirkt zusätzlich entzündungshemmend und angstlösend.

Echtes Cannabis kommt in der Therapie nur selten zum Einsatz: In den meisten Ländern kennen Ärzte nur synthetische Cannabis-Medikamente.
Bisher wird Cannabis vor allem eingesetzt bei der Behandlung von degenerativen Nervenerkrankungen wie multipler Sklerose, bei chronischen Schmerzen, z.B. bei Rheuma, und in der Palliativmedizin. Krebs- und Aids-Patienten berichten von weniger Schmerzen und von der Linderung von Nebenwirkungen durch andere Arzneien, zum Beispiel bei Übelkeit in Folge einer Chemotherapie.
2013 stellte die Molekularbiologin Cristina Sánchez aus Teneriffa bei der Tagung der «Schweizer Arbeitsgruppe für Cannabinoide in der Medizin» die Ergebnisse ihrer Krebsstudie vor. Laut dieser gibt es Hinweise, dass Cannabis-Inhaltsstoffe bei bestimmten Krebsarten das Tumorwachstum hemmen könnten. Auch bei einer Reihe weiterer Krankheiten machen sich Mediziner Hoffnungen: etwa bei Parkinson, Migräne und Alzheimer. Zwar gibt es gegen diese Krankheiten bereits Arzneien, aber diese wirken nicht immer zufriedenstellend und haben manchmal gravierende Nebenwirkungen.
Noch sind manche Forschungsergebnisse wie die aus der Krebsstudie durchaus widersprüchlich und werfen mehr Fragen auf als sie beantworten. Denn noch ist nicht klar, wie die insgesamt über 600 Substanzen der Hanfpflanze miteinander und in Kombination mit anderen Medikamenten agieren.
Mediziner fordern daher schon länger mehr und aussagekräftigere klinische Studien. Sie fragen sich, warum zum Beispiel Cannabinoide in dem einen Fall Übelkeit lindern, ein andermal als Nebenwirkung selbst Übelkeit hervorrufen. Warum manche Menschen schon auf kleine Mengen reagieren, andere jedoch hohe Dosierungen brauchen und wieder andere die Wirkstoffe nicht vertragen oder keine Wirkung verspüren. Warum manchmal eine Kombination aus THC und Cannabidiol effektiver ist als eine Substanz allein, und warum das Verhältnis der beiden eine Rolle spielt. Und schliesslich, warum die ganze Pflanze mit all ihren Inhaltsstoffen bei manchen Patienten besser wirkt als eine einzelne, isolierte Substanz.
Professor Dr. Rudolf Brenneisen, einer der weltweit führenden Köpfe der Cannabis-Forschung und Leiter der Schweizer Arbeitsgruppe für Cannabinoide in der Medizin, forderte: Bei medizinischen Forschungen solle auch die ganze Pflanze verwendet werden, um deren komplexe Wirkmechanismen zu verstehen.
Dabei berief Brenneisen sich auf Erkenntnisse aus dem Jahr 1992: Damals hatten der tschechische Chemiker Lumír Ondrej Hanu und der US-amerikanische Molekularpharmakologe William Anthony Devane den Stoff Anandamid entdeckt. Mit Anand-amid erfuhren die Forscher, dass der menschliche Körper selbst cannabisähnliche Stoffe produziert und dafür eigene Rezeptoren hat. Diese Stoffe befinden sich in allen wichtigen Organen und sind an zentralen Funktionen beteiligt: am Immunsystem ebenso wie an der Regulation von Angst und Schmerz. Interessant ist, dass sie an denselben Rezeptoren an-docken wie beispielsweise das THC des Cannabis. Deshalb, so die Vermutung, reagiert der menschliche Organismus so gut auf Hanfpräparate.

Hasch und Marihuana, Cannabis und Hanf: Wer diese Begriffe gebraucht, meint oft etwas Ähnliches, aber beileibe nicht dasselbe. Hasch und Marihuana sind Bezeichnungen aus der Drogenszene. Haschisch wird aus dem Harz der weiblichen Pflanze gewonnen; Marihuana besteht aus den getrockneten Blüten und Blättern der Pflanze.
Cannabis sativa ist der botanische Name einer Pflanze, die zur Pflanzenfamilie der Hanfgewächse gehört und mit Hopfen und Brennnessel verwandt ist. Die Pflanze mit den gezackten Blättern, die sich wie Finger zu einer Hand spreizen, wächst in verschiedenen Unterarten und Sorten und stammt vermutlich aus Zentralasien.
In der Vergangenheit haftete Cannabis nicht das Stigma eines Suchtmittels an: Schon vor Jahrtausenden hatte die Pflanze in vielen Regionen ihren Platz in der Volksmedizin; sie stand in Arzneimittelbüchern mit Indikationen wie Asthma, Schlafstörungen und Depressionen – und bis heute wird Cannabis in der Homöopathie verordnet. Nicht zuletzt war Cannabis lange Zeit eine beliebte und vielseitige Nutzpflanze – nämlich als schlichter Hanf.
Hanf war wegen der hohen Reissfestigkeit seiner Fasern begehrt: In China, im alten Ägypten und in Rom stellte man Takelagen und Segel für Boote, Kleidung und Papier aus Hanffasern her. Erst mit dem Siegeszug der Baumwolle, dem Rückgang der Segelschifffahrt und der Erfindung von Zellstoff für Papier verschwanden die Hanfkulturen aus der Landschaft. Doch inzwischen entdecken Textilhersteller die Pflanze aufgrund ihrer optimalen Öko-Bilanz wieder: Wegen seiner Inhaltsstoffe kennt Hanfgras kaum Schädlinge; es ist anspruchslos und gedeiht fast überall; es braucht viel weniger Wasser als Baumwolle, lockert als Tiefwurzler die Erde und verbessert die Bodenqualität – so kann es zur Regeneration ausgelaugter Böden eingesetzt werden.