A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.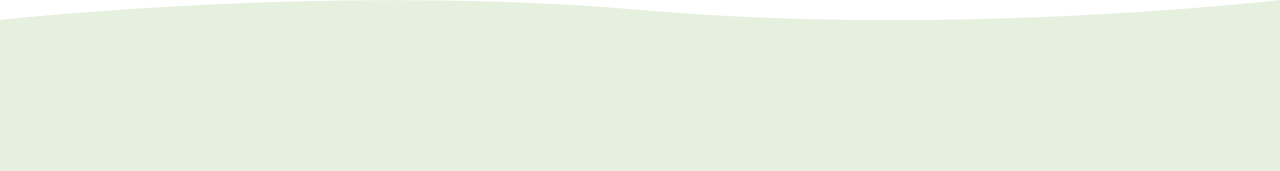
Problematisches Plastik
Heutzutage sind Produkte aus Kunststoffen allgegenwärtig. Die praktischen Helfer im Alltag haben nicht nur Vorteile, in manchen stecken auch Risiken für die Gesundheit.
Einst waren sie der Renner, heute findet man sie als nostalgische Kuriositäten auf den Flohmärkten, die dunkelbraunen und schwarzen Produkte aus Bakelit. Der aus Belgien stammende Chemiker Leo Hendrik Baekeland stellte 1909 in den USA den ersten echten Kunststoff vor. Aus dem billigen und robusten Bakelit produzierte die Industrie unter anderem massenhaft Lichtschalter, Telefonapparate, Haartrocknergehäuse, Verkleidungen von Radioempfängern sowie Ziergegenstände des Art Déco.
Autor: Adrian Zeller
Kulturwissenschaftler sehen in der Erfindung des Kunststoffs vor über hundert Jahren eine ähnlich epochale Veränderung der Kultur wie beispielsweise in der Entwicklung der Bronzeverarbeitung. Bakelit bereitete den Weg ins Plastikzeitalter vor.
Wobei dieser Begriff einen sehr ungenauen Eindruck erweckt: Was umgangssprachlich als Plastik bezeichnet wird, fächert sich heute in eine breite Palette an Werkstoffen mit unterschiedlichsten Eigenschaften auf.
Ab Ende der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts erschienen nach und nach Kunststofftypen auf dem Markt, die gegenüber Bakelit verbesserte Eigenschaften haben. Manche von ihnen sind besonders hitzeresistent, andere extrem belastbar, weitere unempfindlich gegen Säuren.
Ihre zusätzlichen Vorteile liegen auf der Hand: leicht an Gewicht, bruchfest, geringe Produktionskosten, leicht einzufärben, vielseitig einsetzbar, lange haltbar.
Dieser Vorzug ist zugleich auch ein Verhängnis: Kunststoffe verrotten kaum. Werden sie nicht sachgerecht entsorgt, sind sie eine Umweltbelastung. In den Weltmeeren treiben rund 100 Millionen Tonnen Kunststoffmüll, Tendenz steigend. Er stammt hauptsächlich von verlorenen Schiffsladungen, von über Bord geworfenem Abfall sowie aus Treibgut aus Flüssen, die dem Meer zufliessen. Nach Expertenschätzungen verenden an ihm jährlich mehrere hunderttausend Tiere: Seehunde, die sich in grösseren Teilen verheddern, Fische, die Partikel für Plankton halten, und Wasservögel, die sie als Nahrung verschlucken; trotz gefülltem Magen verhungern sie.
Ungefährlichere biologisch abbaubare Kunststoffe sind bereits entwickelt worden, aber sie führen nicht zuletzt aus Kostengründen derzeit ein Nischendasein. Längerfristig könnte sich dies ändern. Dazu müssen die Eigenschaften zum Teil weiter optimiert werden. Biologische Kunststoffe sind derzeit noch weniger widerstandsfähig als herkömmliche und daher nur begrenzt einsetzbar.

Kinderspielzeug aus Plastik: Darauf achten, dass keine bedenklichen Weichmacher enthalten sind.
Das Dasein in der Moderne spielt sich weitgehend mit jeder Menge von Kunststoffen ab:
- Zahnbürsten, Tiegel von Körperpflegeprodukten, Blisterverpackungen von Medikamenten, Vorratsdosen, Joghurtbecher, Latexhandschuhe, Wasserleitungen, Elektrokabel, Armaturen von Autos, Einkaufstüten, Fensterrahmen, Wasserkocher, Schneidebretter, Griffe von Pfannen, Besteck und Werkzeugen, Spielzeug, Blumentöpfe, Sonnenbrillen, Innenbeschichtungen von Konservendosen, Gartenstühle, Gehäuse von Computern und Handys, Damenstrümpfe, Regenkleidung, Beläge von Fussböden – die Liste liesse sich noch um zahlreiche Gegenstände verlängern.
Pro Jahr werden weltweit rund 240 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. In Europa verbraucht eine Person pro Jahr rund 92 Kilogramm unterschiedlichste Produkte aus ihnen.
Ausgangsmaterial vieler Kunststoffe ist Erdöl; 150 Liter davon stecken im Durchschnitt in jedem Haushalt. In chemischen Prozessen werden lange Ketten aus Millionen von Molekülen hergestellt. Im Laufe des Produktionsverfahrens werden Zusatzstoffe beigemengt, so genannte Additive. Sie beeinflussen den Prozess in die gewünschte Richtung. Sie machen etwa das Endprodukt besonders formbar beziehungsweise besonders formstabil.
Es liegt auf der Hand: Ein Schwimmreifen muss anderen Anforderungen genügen als ein Autoreifen. Weitere Beimengungen sorgen für eine erschwerte Entflammbarkeit: Brennender Kunststoff setzt giftige Dämpfe frei.
Ein Teil dieser Zusatzstoffe ist nicht harmlos, sondern kann zur Gefahr für die Gesundheit werden. Einer von ihnen ist beispielsweise DEHP (Diethylhexylphthalat). Er wird vor allem als Weichmacher bei PVC-Produkten eingesetzt.
DEHP wirkt sich auf Nieren, Leber und Hoden schädigend aus. Die Überwachungsstelle der EU für chemische Stoffe, ECHA, will die Substanz bis 2015 verbieten lassen. Bereits jetzt müssen Produkte, die diesen Zusatzstoff enthalten, entsprechend gekennzeichnet sein.
Weichmacher wie DEHP, auch als Phthalate bezeichnet, gehören zu den besonders umstrittenen Stoffen. Die chemische Industrie verwendet rund 25 verschiedene Typen davon. Nicht alle gelten als gesundheitsgefährdend. Jedoch: Als besonders schädlich für die Fortpflanzungsfähigkeit bewertet die EU neben DEHP auch DBP sowie BBP. Die Behörden der Europäischen Union haben daher deren Verwendung in Babyartikeln und Kinderspielzeug untersagt.
Die chemische Industrie weicht auf die Ersatzstoffe DIDP sowie DINP aus, die als ungefährlich gelten. Auch sie dürfen allerdings in der EU aus Sicherheitsgründen nicht in Babyartikeln und Kinderspielzeug vorkommen. Nach dem Wunsch der Behörden sollen die Hersteller langfristig weichmacherfreie Kunststoffe, wie etwa Polyethylen oder Polypropylen, einsetzen.

Endstation Meer: Gigantische Mengen an Plastikmüll gelangen tagtäglich in die Meere; auch dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Zu den besonders problematischen Substanzen gehört auch Bisphenol A (BPA), eine Art Streckmittel bei der Kunstoffherstellung. Es macht den Werkstoff besonders stabil und preisgünstig.
BPA ist beispielsweise in den Innenbeschichtungen von Konservendosen und -gläsern sowie in Frischhaltefolien zu finden. Sein Nachteil: Er wirkt im Menschen wie ein Hormon. Als Folge davon können die Fortpflanzungsfähigkeit sowie der Geschlechtstrieb ungünstig beeinflusst werden. BPA wird daher gelegentlich als Plastikhormon bezeichnet.
Des Weiteren beschleunigt der Stoff das Wachstum von Fettzellen und sorgt damit für Fettleibigkeit. Er steht auch im Verdacht Diabetes, Herzkrankheiten, Allergien sowie Verhaltensaufälligkeiten zu begünstigen. Zwar gibt es verschiedene Hinweise auf diese Risiken, abschliessend bewiesen sind die krankmachenden Wirkungen aber nicht.
Unter Fachleuten werden die Auswirkungen von BPA sehr unterschiedlich bewertet: Während die einen zu sehr grosser Vorsicht raten, stufen andere die Gefahren als weit weniger gravierend ein. Umstritten ist auch der zulässige Aufnahme-Höchstwert pro Tag, der als unbedenklich gilt.
Wegen der erwähnten Allgegenwart von Kunstoffen im Alltag ist BPA mit grossen wirtschaftlichen Inte-ressen verbunden. Die Industrie stellt davon jährlich zwischen zwei und vier Millionen Tonnen her. Die Produzenten haben naturgemäss wenig Interesse, dass der Stoff verboten und vom Markt genommen werden muss. Daher finanziert sie immer wieder Studien, die die Gefahren für die Gesundheit relativieren. Verlässliche Angaben über die tatsächliche Gefährlichkeit sind derzeit nicht erhältlich.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, weitere Untersuchungen durchzuführen, um präzisere Daten über die Risiken von BPA zu bekommen. Die EU hat die Bedenklichkeit des Stoffes ihrerseits mehrfach überprüft und kommt zu dem Schluss, dass es derzeit keine Anhaltspunkte zur Neubewertung der Grenzwerte bei der täglichen Aufnahme gebe. Gleichwohl dürfen innerhalb der EU seit dem 1. Juni 2011 keine Babyflaschen mehr verkauft werden, die Bisphenol A enthalten. Mittlerweile sind im Handel verschiedene Produkte mit dem Vermerk «BPA-frei» erhältlich.
Die Schweizer Gesundheitsbehörden schliessen nach der Auswertung von Analysen der Lebensmittelsicherheitsbehörden anderer Länder, dass die Einnahme der Substanz durch Lebensmittel kein Risiko darstelle. Ein allfälliges Verbot würde ihrer Meinung nach dazu führen, dass die Hersteller auf andere chemische Stoffe ausweichen müssten, über deren Gesundheitsgefahren noch weniger bekannt sei.
Wie kann man als Verbraucherin oder Konsument den Kontakt mit solchen zweifelhaften Substanzen reduzieren? In dem man weniger konservierte Lebensmittel verwendet und mehr auf frisch zubereitete Bio-Gemüse und -Fleisch setzt, rät der deutsche Buchautor und Journalist Hans-Ulrich Grimm. Seit Jahren verfolgt er mit sehr kritischem Blick die Praktiken der Nahrungsmittelindustrie.
Frischprodukte sind nur über kürzere Zeit mit Plastik in Berührung gekommen. Entsprechend geringer sind mögliche Einwirkungszeiten von problematischen Inhaltsstoffen.
Besonders intensiv werden manche Substanzen unter Wärmeeinfluss gelöst. Konkret: Plastikbecher und -schüsseln können im Geschirrspüler das übrige Geschirr mit Bisphenol A benetzen. Und auch in der Mikrowelle kann die Substanz in manchen Behältern besonders intensiv freigesetzt werden. Am besten verwendet man in der Mikrowelle Glasgeschirr. Im Geschirrspüler sollten Kunststoffteile in einem separaten Durchgang gereinigt werden.
Beim Kauf von Spielzeug für Kleinkinder sollte man auf Produkte aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Acetyl-Butyl-Styrol (ABS) achten sie enthalten keine problematischen Inhaltsstoffe. Wo das Herstellungsmaterial nicht speziell vermerkt ist, muss man mit PVC und den entsprechenden heimtückischen Weichmachern rechnen. Insbesondere bei preiswertem Spielzeug aus Fernost kann dies zutreffen.
Manche Spielsachen tragen auch den Vermerk «PVC-frei», «phthalatfrei» oder «weichmacherfrei», ihnen sollte man den Vorzug geben. Als Alternative kann man auch auf Flohmärkten nach gebrauchtem Spielzeug Ausschau halten: Problematische Inhaltsstoffe verflüchtigen sich mit der Zeit als Dämpfe. Secondhand-Spielzeug gibt kaum mehr schädliche Inhaltsstoffe an die Umgebung ab.
Und nicht zuletzt sollte man sich in der eigenen Wohnung umschauen und eventuell renovieren: Bodenbeläge aus Kunststoff können grossflächig schädliche Zusatzstoffe ausdünsten. Das deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, nach Möglichkeit auf Holz, Fliesen oder Teppich umzurüsten.


